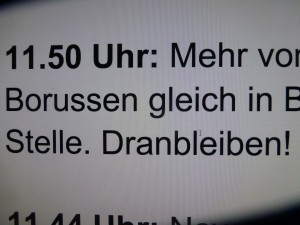„Ein Paar aus vier Menschenhälften“: Frank Schablewski beginnt sein groß angelegtes Romanprojekt „Schwarmbeben“
Ein Mann tötet die Frau, mit der er ein Jahr verheiratet ist. Von Beruf Fleischer, kennt er sich mit dem Handwerk des Ausweidens gut aus.
Fachgerecht zerlegt er den ausgebluteten Körper in vierzehn Stücke, die er, verpackt in fünf Plastiksäcken und mit Steinen beschwert, im Bosporus versenkt.
Erzählt wird uns dieser brutale Mord nicht als Istanbul-Krimi. Kein mit Faszination an der Gewalt geschriebener Thriller ist Ein Paar aus vier Menschenhälften, eher ein Requiem oder eine Elegie in Prosa, an bestimmte Musikformen erinnernd, die immer wieder neu ansetzen und mit unpathetischem Engagement das ähnlich bereits Erfahrene variieren; ein „Mosaik des Todes“.
Eine kunstvoll erweiterte Zeitungsmeldung
„Jemand Fremdes“ liest am Tisch einer Kaffeerösterei in einer stillen Seitengasse im Galata-Viertel (Beyoğlu) die informationsarme Nachricht in der Zeitung. „Der Artikel hielt sich nicht damit auf, die ganze Geschichte zu erzählen. Das Ereignis selbst verbrauchte eine Vorgabe an Zeichen.“ Wer würde je auf die Ermordete einen Nachruf schreiben, wer, wenn nicht der Autor mit dem vorliegenden Buch, das eine auf 160 Seiten kunstvoll erweiterte Zeitungsmeldung übertrifft? Zugleich schreibt er damit einen ausführlichen Grabsteintext auf viele namenlose Frauen, die durch ihre Ehemänner sterben mussten und müssen. Auf die Gewalt der Tat antwortet die Sprachgewalt des Dichters.
So ungeheuerlich ist der Vorgang des Abschlachtens, dass er sich vielleicht nur aus der Sicht der Toten darstellen lässt. Für sie werden die Dinge transparent, ähnlich wie in Vladimir Nabokovs spätem Roman Durchsichtige Dinge (Transparent Things, 1972) – der Blick aus einer jenseitigen Welt auf die unsere, in der das Leben ohne die Tote weitergeht.
Blick aus einer jenseitigen Welt
Aus ihrem nassen Grab blickt die Frau in den Gerichtssaal, in dem der Mordfall verhandelt wird. Sie hört den Richter ihren Mörder von jeder Schuld freisprechen und ihr selbst, dem Opfer, die Verantwortung für ihren Tod zuschreiben. „Für den Richter war es der geborene Mord.“ Sie habe im Grunde alles erlebt, was eine Frau erleben kann, Geburt, Elternhaus, Hochzeit, Ehe, die ein Jahr dauerte, bis der Mann nichts anderes mehr mit ihr anzufangen wusste, als sie zu töten. Für sie wäre „das Leben keine Lösung“ gewesen, hört sie den Richter sagen. Ob aber für den Mann das Weiterleben eine Lösung sein kann, fragt niemand.
Wortreich nutzt der Richter den Fall, um seine Weltanschauung zu unterbreiten, doch in seiner Rede tun sich nur neue Abgründe auf. Er gibt vor, sich „in heroischer Weise der Gerechtigkeit hinzugeben“, und zwar „nicht in der Sprache des Volkes“. Mann, Frau, Richter – diese drei Funktionen bilden die Triade des Tragischen; weitere Personen wie die Familie der Frau oder ihre Anwälte werden nur am Rande erwähnt. Ohnehin hatte die Frau nur Brüder.
Ewiges Gesetz?
„Im Bereich meines gesetzlichen Throns werden die ersten in unserer Sprache geschriebenen Urteile für immer gelten“, sagt der Richter. Und diese gehen stets zu Lasten der Frau. Er ist „der letzte Richter überhaupt“. Der Richter beansprucht für sich ein überzeitliches, ein ewiges, Gesetz. Aber mag es auch der gängigen Praxis entsprechen, ist dieses Gesetz ein bloß behauptetes; „es war das völlige Innehalten des Rechts.“
Detailreich beschriebener Meeresgrund
Auf eine andere Art überzeitlich präsent ist die Ermordete, da für sie die Zeit keine Rolle mehr spielt. „Das Wasser spiegelte das Gesetz“, heißt es im Text. Als nähme uns der Autor mit zu einer Erkundungsfahrt in einem Glasbodenboot, sehen wir jeden Gegenstand, jeden Meeresbewohner, jeden Abfall auch, der den Bewohnern der Stadt unter der sich spiegelnden Oberfläche in der Düsternis der Tiefe verborgen bleibt. Die Tote aber, in fünf zerfetzten Plastiktüten verpackt, fühlt die Algen, die Einsiedlerkrebse, Schnecken und Fische, die sich ihrer Körperteile bemächtigen. In der Meerenge des Bosporus, zwischen den Kontinenten, liegt das nun nicht länger Zusammenhaltende. Am Ende ist wohl alles gesagt, was sich über das Meer und seinen Grund in allen seinen Bedeutungen sagen lässt.
Männerrituale
Weit weniger gründlich wird im Gerichtssaal das Verbrechen untersucht. Vielmehr bestätigen sich die anwesenden Männer gegenseitig in der Richtigkeit des Geschehenen, „Ein Kopf bejahte den anderen“, analog zu den Ritualen, die sich als Tanz von Männern in einem Park abspielen. „Jeder stellte sein Leben mit Gebärden dar, einem ganz eigenen Mienenspiel, in der kurzen Zeit einer Handbewegung. Jeder kreiste um sich selbst.“
Aber noch ein anderes Ritual spielt im Buch eine Rolle – das in Initiationsriten weltweit beobachtete Thema von Zerstückelung und Wiedergeburt, ethnologisch als Übergangsritus bezeichnet. Einen der Ur-Mythen für dieses Muster bildet der zerstückelte Osiris, der von seiner Schwester-Gemahlin Isis neu zusammengesetzt wird. Von einer mythischen Wiederherstellung, Erneuerung, Gesundung des Körpers spricht auch der Richter in Ein Paar aus vier Menschenhälften, versucht, das brutale Verbrechen dadurch zu beschönigen.
Riten des Übergangs
Seismographisch lässt sich bereits an frühen Textstellen das Erdbeben vorhersehen, das am Ende Meer und Erde vermischt. Ein Hain mit Apfelbäumen rutscht als erstes in den Bosporus. Doch bei aller Kunstfertigkeit der Sprache und in der Komposition ist die Lektüre allein schon wegen des todernsten Themas keine leichte Kost – kann es und darf es nicht sein.
Frank Schablewski ist bisher vor allem als Lyriker, Essayist und Autor kürzerer Prosa in Erscheinung getreten. Mit einem Stipendium der Kunststiftung NRW lebte er 2016 mehrere Monate in einer Künstlerresidenz in Istanbul. Bereits zuvor wurden mehrere seiner Gedichte ins Türkische übertragen und der Autor wurde wiederholt zu Poesiefestivals in die Türkei eingeladen. In Deutschland erscheint sein literarisches Werk vorrangig im Rimbaud Verlag in Aachen. Ein Paar aus vier Menschenhälften ist der erste von vier Teilen seines Romans Schwarmbeben. Wir dürfen auf die weiteren drei Teile von Frank Schablewskis groß angelegtem Werk gespannt sein.
Frank Schablewski: „Ein Paar aus vier Menschenhälften“. Rimbaud Verlag, Aachen; 164 S., fadengeh. mit Klappen. ISBN 978-3-89086-224-8, € 25 ,-