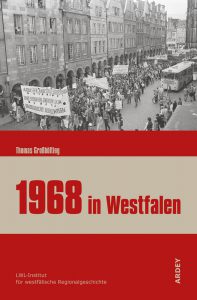Dies und das in Wuppertal
Wuppertal denke ich mir immer etwas abseits, im Windschatten des Ruhrgebiets, meinetwegen auch im toten Winkel von Düsseldorf liegend. Das mag ungerecht sein. Es ist halt nur so ein Gefühl. Und so geht’s auch weiter, nämlich vorwiegend assoziativ.
„Zuckerpuppe“ und Blankenese
Wie es mir jetzt wieder in den Sinn kam, hat es mit der Stadt u. a. folgende, durchaus ulkige Bewandtnis: Sie kam in zwei sehr populären Stimmungs-Schlagern vor – 1961 als Schlussgag in Bill Ramseys „Zuckerpuppe (aus der Bauchtanzgruppe)“, wo jene „Suleika“ gar nicht so orientalisch ist, sondern Elfriede heißt und offenbar just aus Wuppertal kommt. Außerdem zählte die Stadt 1981 zum Zielgebiet in Gottlieb Wendehals‘ Brüller „Polonäse Blankenese“, deren frohsinnstrunkener Weg bekanntlich „von Blankenese bis hinter Wuppertaaaal“ führt, wobei der Erwin der Heidi… Aber lassen wir das.
Fast wie eine Metropole
Galt Wuppertal den Schlagertextern etwa als Inbegriff von Provinz, schon namentlich irgendwie zum Schreien komisch? Sah man in Wuppertal einen gewissen Gegensatz zu allen halbwegs weltläufigen oder frivolen Anwandlungen, sozusagen einen Antipoden von Paris? Oder war es ein nahezu nicht existenter Ort, quasi ein Bielefeld mit anderen Mitteln? Gern würden wir diese Fragen als Forschungsauftrag vergeben – in welchem Fachgebiet auch immer. Wer will es – nun ja – wuppen?
Meine persönlichen Wuppertal-Begegnungen waren nur sporadisch. Als Volontär-Frischling für ein paar Monate in einer Lokalredaktion des Ennepe-Ruhr-Kreises stationiert, durfte ich Tag für Tag die Info-Leiste „Wuppertal“ mit Meldungen füllen, also im Dienste der Leser Blicke in die benachbarte Großstadt werfen. Von Gevelsberg aus gesehen, wirkte es tatsächlich wie eine Metropole.

Imposante Arbeit von Tony Cragg in seinem Wuppertaler „Skulpturenpark Waldfrieden“. (Foto vom 19. Juli 2009: Bernd Berke)
Außenposten zur Bewährung
Jahre später, als Jungredakteur im Kulturressort, wurde ich wiederum zunächst vor allem mit Wuppertal betraut. Während der damalige Ressortleiter die Theater in Bochum und Dortmund aufsuchte, durfte ich anfangs die darstellenden Künste in Wuppertal würdigen, wo das Schauspiel nicht gerade zu den ersten Adressen des Landes zählte. Auch waren zumal die winterlichen Fahrten dorthin nicht immer erfreulich. Wuppertal war ein Außenposten, auf dem man sich erst einmal zu bewähren hatte. Nach und nach, eigentlich recht schnell, weitete sich dann der Horizont. Noch später, als Pina Bausch mit ihrer Wuppertaler Tanztheater-Compagnie immer berühmter wurde, fuhr ich umso lieber dorthin.
Als sich „Tuffi“ aus der Schwebebahn stürzte
Was wäre noch zu erwähnen? Sicherlich die einzigartige, 1901 eröffnete Schwebebahn, aus der sich 1950 ein Zirkus-Elefantenweibchen namens Tuffi zehn Meter tief in die Wupper stürzte und wie durch ein Wunder praktisch unverletzt blieb. Tuffi hatte sich wohl über den Einfall aufgeregt, sie zu Reklamezwecken in die Bahn zu bugsieren. Das Ereignis taucht seither in jeglicher Stadtwerbung auf.
Bemerkenswert auch die Talstraßen, die einem manchmal doch etwas beengt, beklemmend und duster erscheinen mögen. Und dann fällt einem vielleicht noch ein, dass der Cartoonist und Comic-Zeichner Gerhard Seyfried (Klassiker: „Freakadellen und Bulletten“, 1979) Wuppertal auf seiner legendären Deutschlandkarte als „Schnupperqual“ verortete. Wie gemein! Doch andere traf es ebenfalls hart: Dortmund war demnach „Abortmund“, Bochum firmierte als „Malochum“ und Hagen schlichtweg als „Unbehagen“. Was man sich so alles merkt.
„Stütze“ für Karl Marx
Sodann aber die berühmten Töchter und Söhne der Gegend: Ex-Bundespräsident Johannes Rau, der in Wuppertal Geburtsort und Heimstatt hatte. Vor allem aber die Dichterin Else Lasker-Schüler (1869 im späteren Wuppertaler Ortsteil Elberfeld geboren) und der Sozialist Friedrich Engels (1820 im anderen größeren Ortsteil Barmen geboren), ohne den Karl Marx finanziell hätte einpacken können. Von Wuppertal ging also welthistorischer Einfluss aus. Ganz nebenbei: Auch Horst Tappert („Derrick“) und Alice Schwarzer wurden in Wuppertal geboren. Noch nebenbeier: ein gewisser Christian Lindner ebenfalls.
Und ferner? Das oftmals besuchte, mit zahlreichen Meisterwerken gesegnete Von der Heydt-Museum. Der famose Skulpturenpark Waldfrieden. Der Zoo. Gar der Wuppertaler SV, der von 1972 bis 1975 wahrhaftig in der Ersten Bundesliga gespielt hat. Noch erstaunlicher: die rund 4500 (!) Baudenkmäler in Wuppertal, speziell eine enorme Vielzahl an Gründerzeit-Villen. Laut Wikipedia hat Wuppertal zudem die meisten öffentlichen Treppen Deutschlands (469 an der Zahl, mit insgesamt 12383 Stufen).
Verblüffend auch die nicht allgemein bekannte Tatsache, dass Fassbinder „Acht Stunden sind kein Tag“ ebenso in Wuppertal gedreht hat wie Wim Wenders Teile seines Roadmovies „Alice in den Städten“. Dessen eingedenk, tun weniger schmeichelhafte Redewendungen wie „Über die Wupper gehen“ (nahezu bruchlos ersetzbar durch „Über den Jordan gehen“) nicht mehr so weh.
Lassen wir’s gut sein. Eine solche Orts-Skizzierung aus der Distanz setzt sich aus lauter Klischees und Zufallseindrücken zusammen. Wie es sich anfühlt, dort zu leben, sei dahingestellt. Es soll aber auch nicht erprobt werden. Es sei denn, unter Euch wären Freiwillige…