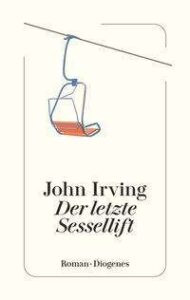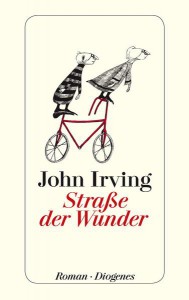„Unser Geschäft ist die Fantasie“ – John Irvings Roman „Der letzte Sessellift“
Ob „Garp und wie er die Welt sah“, „Lasst die Bären los!“, „Bis ich dich finde“, „Letzte Nacht in Twisted River“: Alle Romane von John Irving wurden internationale Bestseller, manche auch erfolgreich verfilmt. Für das Drehbuch von „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ bekam Irving sogar einen Oscar. Seine Bücher sind oft viele hundert Seiten stark, auch der neue Roman, „Der letzte Sessellift“, ist mit 1079 Seiten gewichtig.
Irving greift noch einmal in die Trickkiste, entwirft ein üppiges Gesellschaftspanorama der USA, thematisiert die eigene Familiengeschichte und die politischen Abgründe Amerikas, beklagt die Bigotterie eines Landes, das Homosexuelle verfolgt, aber den von kirchlichen Würdenträgern begangenen Kindesmissbrauch vertuscht. Es gibt deftige Erotik, herbe politische Anklagen, bizarre Handlungsfäden, mit denen Irving meisterlich jongliert.
Wieder gibt es klein gewachsene Menschen und lange Passagen über das Ringen, jede Menge Sex, der zu unliebsamen Verletzungen führt, rätselhafte Familien-Verhältnisse und ungeklärte Vaterschaften, starke Frauen und schwache Männer, einen Erzähler, der in New Hampshire aufwächst und viele Jahre nach seinem Erzeuger sucht, also John Irving recht ähnlich ist: auch er ein passionierter Ringer, der mit einer starken, allein erziehenden Mutter aufwuchs und fast fünfzig werden musste, bis er die Identität seines Vaters herausbekam. Doch es gibt diesmal keine Bären, die einem die Hand abbeißen oder die man mit der Bratpfanne in die Flucht schlagen muss: dafür aber ein literarisches Alter Ego, das die USA nicht mehr ertragen kann, die kanadische Staatsbürgerschaft annimmt und – wie Irving – nach Toronto zieht.
Adam Brewster führt uns von seiner Geburt im Jahre 1941 bis in die direkte Gegenwart. Er hat eine kleinwüchsige Mutter, Rachel, genannt Little Ray, die eine erfolgreiche Ski-Läuferin war und bis ins hohe Alter als Ski-Lehrerin arbeitet. Bei einem Ski-Rennen in Aspen, da ist sie gerade einmal 18, lässt sie sich von einem Vierzehnjährigen schwängern. Sie benutzt den Jungen als Samenspender, denn sie ist lesbisch und lebt mit Molly zusammen, einer Pisten-Pflegerin und Ski-Retterin. Um die gesellschaftlich geächtete Beziehung zu kaschieren, heiratet sie pro forma einen Mann, der zu ihr passt: Auch er ist klein und schlüpft gern in Frauenkleider. Adam liebt dieses sensible Wesen abgöttisch. Er liebt auch die Großmutter, die ihm Melvilles „Moby-Dick“ vorliest und in die Geheimnisse der Literatur einweist, den dementen Großvater, der zum Kleinkind mutiert und in Windeln herumläuft. Er liebt Nora, seine lesbische Cousine: zusammen mit „Em“, die sich nur pantomimisch ausdrückt, tritt sie in einem New Yorker Comedy-Club auf, nimmt in ihrem Programm „Zwei Lesben, eine spricht“ die politischen und sexuellen Verirrungen in den Vereinigten Staaten aufs Korn und wird von einem homophoben Zuschauer während der Vorstellung erschossen.
Besonders absurd sind die Reisen, die Adam unternimmt, um seinen Vater kennenzulernen, einen kleinwüchsigen Schauspieler und Drehbuchautor, der in Aspen aufgewachsen ist und immer wieder an den Ort seiner Kindheit und ins Hotel „Jerome“ zurückkehrt. Als Adam im „Jerome“ absteigt, trifft er die Gespenster von Toten wieder, die er als Kind in seinen Alpträumen gesehen hat und die jetzt in der Bar abhängen und Country-Musik hören. Adam hat die Filme seines Vaters studiert, jetzt beschreibt er die Begegnung mit ihm als Drehbuch, mit Regie-Anweisungen, Dialogen, Voice-Over, Musik-Einspielungen: Ganz großes Kino, total abgedreht, allein diese Sequenzen lohnen die Lektüre des Romans, in dem Protagonisten aus dem Sessellift fallen und sich zu Tode stürzen, oder krank, alt und des Lebens überdrüssig nachts in eisiger Kälte auf dem Berg bleiben, sich mit Alkohol betäuben und den Freitod wählen, dann steif gefroren morgens mit dem Sessellift nach unten gebracht werden.
Das alles ist fürchterlich traurig, aber auch ungeheuer komisch. Zur großen Liebe seines Lebens sagt Adam einmal: „Es gibt einen Grund, warum wir Romane schreiben. Das wahre Leben ist zum Kotzen. Unser Geschäft ist die Fantasie.“ Damit ist der Roman so prall gefüllt, dass er fast überläuft.
John Irving: „Der letzte Sessellift“. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg. Diogenes, Zürich 2023, 1079 Seiten, 36 Euro.