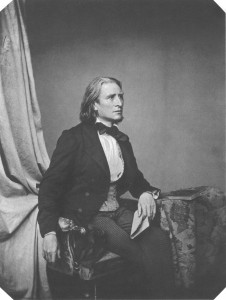Wie Eberhard Kloke in Essens Philharmonie Miltons „Verlorenes Paradies“ in Szene setzt

„Paradise lost“: Ein ausgewaideter Oldtimer als Verlustsymbol, dazu Mahlers Musik und Endzeitgedichte von Heiner Müller. Foto: Sven Lorenz
Ein Wiedersehen mit Eberhard Kloke im Ruhrgebiet. Der Denker und Dirigent, Projektentwickler und Regisseur, Komponist und Arrangeur gibt sich die Ehre in Essens Philharmonie. Mit einer nahezu monströsen Collage aus Text, Bild, Musik, Installation und Performance. Nun, es geht ja auch um etwas. Um den gefallenen Engel, die Ursünde und die Vertreibung aus dem Paradies. Um einen Disput mit dem Teufel über die Existenz Gottes. Um Idylle und Zerstörung, Romantik und Realität. Kurz: Bei Eberhard Kloke geht’s mal wieder ums Ganze.
„Paradise lost“ heißt sein Programm, konzipiert nach dem gleichnamigen Gedicht des Briten John Milton, der in epischer Breite schildert, wie der Mensch aus dem Garten Eden verjagt wurde. Wir wissen um die Konsequenzen. Und Kloke führt sie uns in seiner dreiteiligen Inszenierung vor Augen, meißelt sie uns bisweilen in die Ohren, ja lässt sie uns an einer Stelle sogar riechen. Liebe, Glaube, Hoffnung – alles dahin. Kein Trost, nirgends.
Es beginnt mit Peter Schröder. Als Rezitator vorgestellt, ist er weit mehr: wunderbarer Schauspieler, exzellenter Wortakrobat und hinreißender Dialogpartner seiner selbst. „Seltsame Dinge werden geschehen“, zitiert er eingangs Edgar Allan Poe, um dann mit Heiner Müller ein langes Leben im Wohlstand dem Paradiese vorzuziehen. Später wird Schröder uns in aller Textverständlichkeit und Plastizität Milton nahebringen. Oder aus Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ den Alptraum Iwans – das halluzinierte Gespräch mit dem Teufel – aufs Schönste rezitieren.
Musikalisch setzt Kloke auf Werke von Charles Ives, Berlioz, Edgar Varèse, Ivan Wyschnegradsky, Mahler und Berg. Kein Ohrenschmaus im klassisch-romantischen Kontext also, vielmehr hochkomplexe Bekenntnismusik. Mit Ives’ „Dich, Gott, loben wir“, einer großorchestralen, klanggeschichteten, polyrhythmischen und vom Chor unterstützten Anbetung scheint die Welt noch in Ordnung. Doch der Brite schuf das Werk im Angesicht des 1. Weltkriegs. In Klokes Konzeptkonzert ist es also ein Dokument eben jener Zerstörung, die die Vertreibung aus dem Paradies auslöste. Zwei Naturbilder werden projiziert, wie aus dem Albumblatt. Dann fangen sie Feuer, bleiben angekokelt zurück: allüberall Symbolik.
Das ist penibel inszeniert, nichts scheint dem Zufall überlassen. Kloke setzt auf die Kraft von Bild und Ton, von Sprache und Licht. Das wirkt so intellektuell wie berauschend, erkenntnisfördernd wie verstörend. Zwischenbeifall weist der Künstler soweit möglich zurück. Ein bisschen, so scheint’s, setzt sich dieser freigeistige Macher auch selbst in Szene.
Vor seiner konzisen, zunächst absurd scheinenden, dann aber umso sinnfälligeren Performance namens „Über die Grenzen des All“ (das zweite der fünf Altenberg-Lieder Alban Bergs) darf allerdings getrost der Hut gezogen werden. Mulch bedeckt den Boden, gewissermaßen als stummer Zeuge ewigen Werdens und Vergehens, inmitten des kleinen Saals ein ausgewaideter Oldtimer. Schauspieler Peter Schröder, in der Kluft eines Automechanikers, sorgt sich offenbar um dieses Gefährt, berührt es mit sanfter Hand, umrundet es. Eine Art Götzenanbetung scheint dies, und dazu zitiert Schröder Endzeitgedichte Heiner Müllers. Währenddessen die exzellente Sopranistin Kim-Lillian Strebel in schillerndsten Farben frühe Mahler-Lieder interpretiert, Gesänge von Liebe, Tod und dem großem Weltenweh. Das achtköpfige E-MEX-Ensemble liefert dazu Klokes Instrumentalfassung, ergänzt durch elektronische Zuspielung, die dieser Performance die Aura des Imaginären verleiht. Ein Kammerspiel von Verlust, Verfall, Verzweiflung.
Die Videoinstallation „Parsifal reloaded“ hingegen, mit zerrupfter, fragmentierter Musik aus Wagners Erlösungsdrama, dazu Bilder vom Verfall in der Zivilisation, gehört zu jenen „L’Art pour L’Art“-Gebilden, die kaum mehr als ein Schulterzucken auslösen. Da widmen wir uns lieber der Mahlerschen Wunderhorn-Magie, wenn Kloke und Kim-Lillian Strebel noch einmal die frühen Lieder im großorchestrierten Arrangement ausdeuten.

Die Sopranistin Kim-Lillian Strebel, Dirigent Eberhard Kloke und die Essener Philharmoniker. Foto: Sven Lorenz
Kein Trost, nirgends? Vielleicht liegt er eben in der Schönheit der Musik. Die Essener Philharmoniker jedenfalls glänzen nicht zuletzt mit Bergs Liedern, diesen meisterlich kolorierten Aphorismen, von der Mezzosopranistin Ezgi Kutlu feinherb gesungen. Exzellent musizieren im übrigen Bläser und Schlagzeug in Varèses „Déserts“ – pointierte Rhythmik trifft auf harsche, gleißende Klänge.
Am Ende darf gesagt werden: Dieses Konzeptkonzert ist im großen und ganzen gelungen. Dank exzellenter Interpreten lässt sich das Publikum konzentiert ein auf dieses ungewöhnliche Format. Bemerkenswert auch, wie souverän sich das Orchester in der Neuen Musik bewegt. Damit setzt es ein Zeichen, das bereits in die neue Saison ragt. Es ist aber auch eine Verbeugung vor dem jetzt scheidenden Philharmonie-Intendanten Johannes Bultmann. Der sich der Moderne verpflichtet fühlt. Und wir halten es einmal mehr mit Nietzsche: „Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum“.
Der Text ist zuerst in kürzerer Form im Westfälischen Anzeiger (Hamm) und in der WAZ (Essen) erschienen.