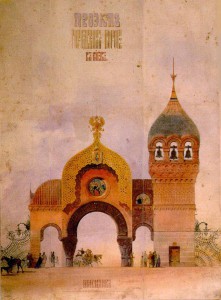Wehmut und Dankbarkeit: Das Auryn Quartett verabschiedet sich mit einem Konzert in Duisburg
Das Auryn Quartett hat alles erreicht, was ein Kammermusikensemble nur erreichen kann. Nun ist nach 41 gemeinsamen Jahren Schluss.

Das Auryn Quartett. Foto: Manfred Esser
Die Vierer-Formation hat vom Wiener Musikverein über die New Yorker Carnegie Hall bis zu den Salzburger Festspielen alle großen Säle und Festivals bespielt; sie hat sich ein unglaublich breites Repertoire von Joseph Haydn bis Wolfgang Rihm erarbeitet, Werkzyklen von Beethoven bis Bartók aufgenommen und sich mit der Gesamteinspielung aller Streichquartette Joseph Haydns ein unsterbliches Denkmal gesetzt.
Vor allem spielt das Quartett seit 41 Jahren in der gleichen Besetzung und gehört damit zu den Ensembles mit der längsten Kontinuität: Die Geiger Matthias Lingenfelder und Jens Oppermann, der Bratscher Stewart Eaton und der Cellist Andreas Arndt hatten sich beim Studium an der Kölner Musikhochschule zusammengefunden und 1981 beschlossen, ein Quartett zu bilden. Bereits ein Jahr später waren sie u.a. beim ARD-Wettbewerb erfolgreich. Nach 40 Jahren sollte Schluss sein. Corona ist es zu verdanken, dass es 41 Jahre geworden sind. Aber am 27. Februar setzt das „allerletzte Abschiedskonzert“ in der Elbphilharmonie Hamburg den unverrückbaren Schlusspunkt. „Wir wollten aufhören, wenn wir noch oben sind im Niveau“, erklärt Stewart Eaton im WDR, einem Sender, dem das Auryn Quartett viel verdankt und für den es unvergessliche Aufnahmen eingespielt hat.
Zuvor jedoch, zum vorletzten Konzert, kamen die vier Musiker aus dem Rheinland – sie lebten auch rund 20 Jahre in Köln – noch einmal nach Duisburg. Hier waren sie 2013/14 „Artist in Residence“ bei den Duisburger Philharmonikern, spielten 2018 Beethoven und gemeinsam mit der Geigerin Carolin Widmann und dem Pianisten Alexander Lonquich Ernest Chaussons wundervolles Konzert für Violine, Klavier und Streichquartett.
Herzzerreißender Abgesang
Jetzt gab es in der Mercatorhalle einen bewegenden, warmherzig beklatschten Abschiedsabend mit Mozarts „Kleiner Nachtmusik“, Antonín Dvořáks Es-Dur-Streichquartett op. 51 und Franz Schuberts d-Moll-Quartett „Der Tod und das Mädchen“. Ein herzzerreißender Abgesang auf das Leben, den das Auryn Quartett mit der Zugabe in serener Milde vergoldete: Das Adagio aus dem „Lerchen-Quartett“ op. 64/5 von Joseph Haydn verströmt in seinem ruhevollen Puls und im makellosen Zusammenklang eine enthobene Ruhe, einen Kontrast zur Todesverzweiflung Schuberts, als hätte Haydn dem düsteren Tod den himmlischen Paradiesesfrieden entgegen gesetzt.
Dass dem Wiener Meister das Finale des Abends gebührt, hat seinen Grund. Das Auryn Quartett fühlte sich Haydn stets besonders verbunden. Auf die Frage in einer dem Quartett gewidmeten „Tonart“-Sendung im WDR nach dem Höhepunkt seiner Laufbahn verwies einer der Musiker auf die Gesamteinspielung aller Haydn-Quartette. „Alle 68 sind auf ihre Art ganz tolle Musik und ermöglichen so viele Entdeckungen.“
Doch die nach dem magischen Amulett aus Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ benannte Formation gehört nicht zu der Fraktion, die ihre Klangvorstellung auf makellos lasierte Töne in perfekter Mischung aufbaut. Sicher, ein Unisono wie der Beginn der Mozart’schen „Kleinen Nachtmusik“ ist aus einem Guss. Aber durch die Fortspinnung, flott und mit Energie gegeben, windet sich die eine oder andere prägnante Nebenstimme, ist die Klangpolitur nicht schmeichelnd sanft, sondern auf die Individualität der Stimmen bedacht. Den fehlenden fünften Satz, der im Original entfernt wurde, ersetzt das Quartett mit dem Menuett KV567/3 aus den „Sechs deutschen Tänzen“. So beherzt und ungekünstelt musiziert, macht der Ohrwurm wieder richtig Spaß.
Dichter Satz, differenzierte Transparenz
Die Kunst, ineinander verwobene Stimmen in ihrer Individualität zu achten, musikalisch sinnvoll zu gewichten und dennoch den dichten Satz nicht zu zergliedern, sondern als klangliches Ganzes erleben zu lassen, führt das Auryn Quartett mit dem Es-Dur-Quartett Dvořáks vor. Wieder steht eher das Temperament als die vollendete Klangkultur im Vordergrund, wird das genaue Hinhören eingefordert. Die Anstrengung wird belohnt, weil die Transparenz nicht analytischer Selbstzweck ist, sondern einem klarsichtigen Durchdringen des Werks dient. Wolfgang Rihm hat es in einem Interview einmal so ausgedrückt: „Das Streichquartett ist eine Besetzung, die es erlaubt, aus der Homogenität heraus in die Bereiche des Heterogenen, ja des Disparaten zu gelangen.“ Treffender könnte der Ansatz des Auryn Quartetts nicht beschrieben werden.
Das „Disparate“ ist dann in radikaler Konsequenz in Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ gefordert. Das betrifft die Klanglichkeit, deren Spektrum von den schrill-schmerzlichen Eröffnungsakkorden bis in täuschend gemütliche Ländler-Leichtigkeit reicht. Das umschreibt aber auch die Emotionalität dieses Ausnahmewerks, dessen seelische Abgründigkeit selbst in Schuberts Œuvre nicht so leicht wiederzufinden ist. Im Angesicht des Todes gibt es eben keine Kompromisse mehr.
Da insistiert die innere Unruhe des ersten Satzes mit einem selten so genau und gewichtig zu erlebenden Cello; da mischen sich aber auch, wenn sich Andreas Arndt mit seiner dunklen Farbe herausnimmt, die Klänge der Violinen und der Viola zu einer schimmernden Fläche, die jedoch nicht lockend glüht, sondern schmerzlich brennt. Der zweite Satz beginnt mit gläsern gelassenen, fast vibratolosen, allmählich intensiveren Tönen. Die Musiker verfolgen die allgegenwärtigen Melodiezitate und -bruchstücke in filigraner Transparenz und schier unendlichen Beleuchtungsnuancen. Das Scherzo spricht in seinem Grimm der Bezeichnung Hohn, es ist, kontrastiert von einem wehmütigen Trio, eine wilde Verzweiflungsjagd, die sich im Presto des Finales– trotz des Tempos genau artikuliert – noch steigert.
Das Auryn-Quartett präsentierte sich ein letztes Mal auf der Höhe seines erfahrungsgesättigten Könnens: Ein Abschied, der schwer fällt, aber in dem die Erinnerung an eine so lange Zeit außerordentlichen Musizierens die Wehmut mit Dankbarkeit mildert.