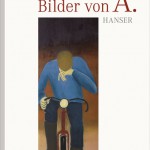Der Salzburger Dom: Prachtvolle Kulisse für den "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen. Foto: Werner Häußner
Heute ungewöhnlich, wie klar sich Alexander Pereira bekennt: Er glaubt an Gott. „Ich bin ein alter Jesuitenschüler“, sagt er in einem Interview, in dem er seine Entscheidung begründet, den Salzburger Festspielen künftig eine „Ouverture spirituelle“ voranzustellen. Der neue Intendant möchte die geistliche Musik ins Blickfeld rücken. Christlich geprägte Werke sollen künftig auf solche aus anderen Weltreligionen treffen, jedes Jahr eine andere: 2013 ist der Buddhismus dran, 2014 der Islam.
Zum Auftakt seiner ersten Salzburger Festspielzeit setzte Pereira einen jüdischen Schwerpunkt, mit Musik, die nicht jeden Tag zu hören ist: Das Israel Philharmonic Orchestra spielte unter Zubin Mehta Ernest Blochs „Avodath Hakodesh“ (Gottesdienst). Mit Noam Sheriffs „Mechaye Hametim“ (Auferweckung der Toten), einer 1985 entstandenen großen Symphonie mit Chor, Orchester und Solisten, kam ein zeitgenössischer israelischer Komponist zum Zuge. Und von einem Klassiker der Moderne, Arnold Schönberg, stammt „Kol Nidre“, für das er melodische Elemente aus Musik zum jüdischen Jom Kippur verarbeitet hat.
In diese Reihe darf man Igor Strawinskys „Psalmensymphonie“ getrost einordnen. Bilden doch drei alttestamentliche Psalmtexte die Grundlage, die zum jüdischen wie zum christlichen Gebets- und Traditionsschatz gehören. Als Person schlägt Strawinsky eine Brücke zur orthodoxen Christenheit, als Musiker verleugnet er die Spuren russischer Kirchenmusik auch in diesem Werk nicht. Um das Jahr 1930, in dem die Symphonie entstanden ist, praktizierte er seinen Glauben explizit und setzte sich mit religiösen Fragen auseinander. Mit den Wiener Philharmonikern und der vorzüglichen Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verständigte sich Valery Gergiev auf einen ruhigen, unspektakulären Zugang mit breit gefächerten dynamischen Nuancen zwischen Pianissimo und Mezzoforte.
Strawinsky hat sich bei der Musik zu Psalm 38, 39 und 150 von religiöser Emphase fern gehalten. Er schreibt Musik wie eine mittelalterliche Miniatur: farbenprächtig, aber objektivierend. Und Gergiev folgt dieser „darstellenden“ Linie. Die Flexibilität des Chores, die ruhig-schwingenden Tempi des Dirigenten, die strukturerhellende Transparenz des Orchesters passen bestens. Wenn in „Alleluja. Laudate Dominum“ das „in sanctis Eius“ verhalten-scheu erklingt, ist man an die große östliche Tradition der Heiligenverehrung erinnert. Kein Triumph, keine Verherrlichung, sondern ein ehrfürchtiges Sich Nähern mag diese musikalische Wiedergabe widerspiegeln.
Die Eröffnungskonzerte der „Ouverture spirituelle“ zeigen eine dramaturgisch bewusste Konzeption: Am Beginn stand – wie künftig in jedem Jahr geplant – Joseph Haydns „Schöpfung“, eine hochgelobte Aufführung unter John Eliot Gardiner; im nächsten Jahr soll sie Nikolaus Harnoncourt dirigieren. Es folgte der „Messias“ unter Daniel Harding, ein Schlüsselwerk in der Geschichte des Oratoriums. Mit der c-Moll-Messe KV 427, die Mozart selbst bei seinem letzten Salzburg-Besuch 1783 dirigierte, wurde dem musikalischen Genius loci gehuldigt.
Im Laufe der Saison, die bis 2. September ausgedehnt wurde, folgen mit der „Messe solennelle“ von Hector Berlioz am 15. August und der „Messa da Reqiuem“ Giuseppe Verdis als Abschlusskonzert am 1. September weitere bedeutende Schöpfungen aus der geistlichen Sphäre. Während die Festspiele auf diese Weise eher eine Reihe der beliebtesten „Highlights“ präsentieren – was sich künftig der Profilierung halber nicht fortsetzen sollte –, brachte etwa die Salzburger Dommusik im Sonntagshochamt eine der zwanzig Messen von Luigi Gatti, dem Hofkapellmeister Fürsterzbischof Colloredos und damit Vorgesetzten von Leopold Mozart.
Der Anfang mit der „Schöpfung“ lässt sich durchaus programmatisch für die philosophische Ausrichtung der „Ouverture sprituelle“ verstehen. Haydn schrieb kein Oratorium für die Kirche, sondern für eine gebildete Gesellschaft, für die freilich christlicher Glaube und die Ausrichtung an christlichen Prinzipien Teil ihres geistigen Lebens war. Der Schöpfungslaube, den Gottfried van Swietens Libretto voraussetzt, verbindet nicht nur Juden, Christen und Muslime. Dass am Beginn allen Existierenden eine wie auch immer geartete göttliche Setzung steht, ist Gemeingut aller Religionen. So spiegelt die „Schöpfung“ Rückbezug auf Gott, Freude an der Natur, aufklärerisches Denken, aber eben auch ein Bewusstsein für das – wenn auch sehr allgemein zu verstehende – Gemeinsame aller Religionen, formuliert auf der Basis eines christlich-jüdischen Schöpfungsbegriffs.
Ein Projekt wie die „Ouverture spirituelle“ ist in Gefahr, zu einem Wohlfühlprogramm mit beliebten Werken und beliebigen Inhalten zu degenerieren. Um ein postmodernes kulturelles Konsumprogramm mit spiritueller Prägung zu vermeiden, bieten die Festspiele gemeinsam mit den Herbert-Batliner-Europainistitut ein Begleitprogramm an. Wie beim „Jedermann“ mit seinem aus dem geistlichen Spiel stammenden Parabel-Charakter bleibt es dem Zuschauer überlassen, ob er sich innerlich berühren lässt, ein Häppchen moralische Genugtuung aufnimmt oder sich Hoffmannsthals Appell lediglich als beeindruckendes Produkt einer Kulturepoche zu Gemüte führt. Wer die aus Antike, Christentum und Aufklärung ererbte Idee, Bildung könne den Menschen zum vollkommeneren Menschsein führen, nicht ganz aufgeben will, wird den spirituellen Schwerpunkt zu Beginn der Festspiele – der dessen ureigensten Intentionen entspricht – nur begrüßen können.
Nicht nur christlich, sondern ausgeprägt katholisch war das Programm eines Konzerts, mit dem Nikolaus Harnoncourt und sein Concentus Musicus im Salzburger Dom zu Gast waren. Die „Missa Longa“ (KV 262) und die Litanei zum Allerheiligsten Altarsakrament (KV 243) sind beide in Salzburg uraufgeführt worden: die „Litaniae de venerabili altaris sacramento“ zum Palmsonntag 1776, die Messe – durch das Schreibpapier des Autographs auf 1775 zu datieren – vermutlich im gleichen Jahr im Dom oder in Sankt Peter. Beide geben ein glanzvolles Zeugnis für das Können des 19jährigen Konzertmeisters im Dienste Colloredos. Mit der Messe scheint Mozart alle kontrapunktischen Künste zum Lob Gottes – auch zum Ohrenschmeichel seines Dienstherrn und der Selbstbestätigung seiner Kunst – eingesetzt zu haben. Und die „Litaniae“ geben Zeugnis vom Einfallsreichtum des Komponisten, der jeder Wiederholung des „miserere nobis“ eine eigene Farbe, einen spezifischen Ausdruckswert geben konnte.
Harnoncourt dirigierte beide Salzburger Höhepunkte der Kirchenmusik – in Wien hatte Mozart ja leider keine Gelegenheit mehr, auf diesem Feld zu brillieren – mit ausgefeilter Sorgfalt im Detail. Die Reaktionsschnelligkeit seines Orchesters, der vokale Expressionswille des Arnold-Schönberg-Chores, verhallten leider in der unergründlichen Akustik des Domes. Ein Grund ist wohl: Musiziert wurde im Altarraum, nicht auf der Empore, wie es für eine Kirche eigentlich vorgesehen ist.
Auf Wunsch Harnoncourts wurden extra die Tapisserien aus dem Dommuseum aufgehängt, um die akustischen Verhältnisse der Mozartzeit anzunähern. Leider umsonst: Der Nachhall überflutete die sorgsam ausmodellierten dynamischen Kontraste; jedes Forte verurteilte ein nachfolgendes Piano zum Tod durch Ertrinken. Zudem neigt Harnoncourt in der Messe zu raschen, energischen Tempi und kleinteiliger Artikulation.
Auch die Solisten Sylvia Schwarz, Elisabeth von Magnus, Jeremy Ovenden und Florian Boesch versuchten meist vergeblich, ihre Stimmen zu profilieren. In den „Litaniae“ hatten die Musiker dank des langsameren Tempos und des musikalischen Pathos mehr Chancen auf fassbar gestalteten Klang. Harnoncourt beleuchtete theologische Schlüsselworte wie „supersubstantialis“ oder das – von Mozart in eine exotisch-dunkle Klangfarbe gekleidete – „Viaticum“, die Wegzehrung derer, die im Sterben zu Gott streben. Ansonsten musste man in Kauf nehmen, was als Gleichnis für unsere Zeit stehen könnte: Das Wort verhallte unverstanden.