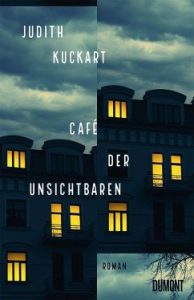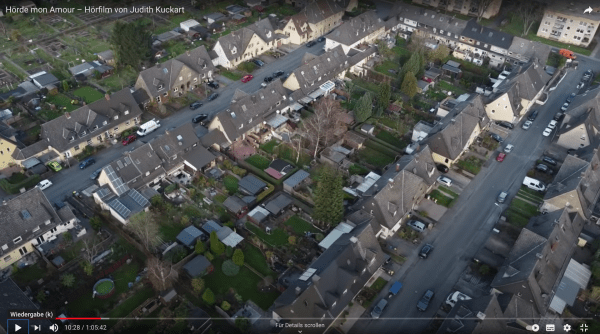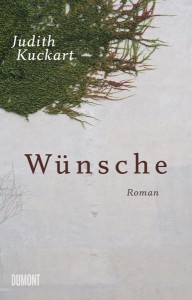Erzählstoff überall – Judith Kuckarts „Die Welt zwischen den Nachrichten“
Jede(r) möge es für sich bedenken: Welche – mehr oder weniger vagen – Berührungspunkte hatte mein Leben mit der Sphäre der Nachrichten? Und was folgt womöglich daraus? Judith Kuckart schneidet derlei Fragen in ihrem neuen, autobiographisch grundierten Roman „Die Welt zwischen den Nachrichten“ keineswegs umweglos an, sondern vielschichtig, hintergründig, zuweilen auch irrlichternd.
Staunenswert, welche Zeitlinien bis in die westfälische Provinzstadt Schwelm reichten, in der Judith Kuckart am (west)deutschen Einheits-Feiertag (17. Juni 1959) geboren wurde. Da war etwa die Schwelmer Apothekertochter Ina, die öfter auf die kleine Judith aufgepasst hat und sich Jahre später in Berlin (im Gefolge des Attentats auf den Studentenführer Rudi Dutschke) links radikalisiert hat. Noch etwas später war sie auf Plakaten der RAF-Terrorfahndung zu sehen und dürfte sich danach in der noch real existierenden DDR versteckt haben. Womit ihre Geschichte noch nicht zu Ende war. Der „Deutsche Herbst“ ist überhaupt prägend gewesen: Als Judith Kuckart in Köln studiert, wird ganz in der Nähe der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer von der RAF entführt und bald darauf ermordet. Aber was ändern solche Koinzidenzen am täglichen Sein?
„Alle Geschichten gehören irgendwie zusammen“
Etliche Befunde und Annahmen über die Lebenswelt „zwischen den Nachrichten“ müssen in einem Roman erzählend überprüft und geformt werden. „Schreibe ich“, so lautet mehrfach das lakonisch innehaltende Zwischenfazit nach gewissen Erzählpassagen. Also kein blankes „So (und nicht anders) war es“, sondern „So ist es aus meiner Sicht gewesen“ oder noch skeptischer: „So könnte es gewesen sein“. Eigentlich, darauf läuft ein Hauptstrang des Buches hinaus, sind sowohl öffentliche als auch vermeintlich private Geschehnisse just Erzählstoff, der aus Buchstaben, Worten, Sätzen usw. besteht und sich hier wieder einmal zum Roman weitet. „Alle Geschichten gehören irgendwie zusammen“, heißt es schon auf Seite 57. Und kurz vor Schluss, auf Seite 186: „Am Ende gilt doch nur das Erzählen. Wer erzählt, kann Engel über Toronto fliegen lassen oder Möwen über den Bahnhof Zoo.“
Jegliches Menschenleben enthält exemplarische, aber auch scheinbedeutsame Vorfälle in Hülle und Fülle. Bei Lebensneugierigen wie Judith Kuckart steigern und verdichten sich die Kreuz- und Querbezüge wahrscheinlich. Jedenfalls werden sie ungleich schlüssiger erzählend verknüpft. Allerdings gilt erzählerische Distanz, denn: „(…) man weiß immer erst im Nachhinein, dass das, was man gerade erlebt, ein Stoff zum Erzählen ist. Denn wer sagt schon, Achtung, jetzt erlebe ich gerade eine Geschichte…“ Außerdem heißt es auf Seite 161, wie in Gedichtzeilen gesetzt:
„Das Seltsame an der Wirklichkeit ist
sage ich wieder und wieder –
dass jedes Ereignis auch ganz anders hätte stattfinden können.“
Eindrücke von Pina Bausch bis Pierre Brice
Nur mal ganz kursorisch aufgegriffen: Mit 15 Jahren taucht die tanzbegeisterte und dito begabte Judith ein einziges Mal inkognito beim nahe Schwelm gelegenen Wuppertaler Tanztheater der legendären Pina Bausch auf. Als Regisseurin und Tänzerin frönt die Schwelmerin später weiterhin der Tanzleidenschaft. Ihr Roman gliedert sich denn auch in eine Reihe von Theater-Kantinengesprächen. Nach dem Abi arbeitet sie vorübergehend in einer Lokalredaktion der Schwelmer Nachbarschaft und interviewt sogleich den Kino-Winnetou Pierre Brice. (Das erinnert mich, mit Verlaub, an meine Volontärzeit, die ein paar Jahre früher zeitweise in dieselbe Gegend – nach Gevelsberg – führte).
Die Eltern und sonstigen Vorfahren der Autorin kommen im Verlauf des Romans ebenso in Betracht wie eine Cousine, die mit zehn Jahren stirbt, die besonderen Frauen Ellen R. und Eva K., die Freundin „Bee“, die spiegelbildlich von ihren Vätern so benannten Judith Martina (also die Erzählerin) und Martina Judith, wodurch weitere biographische Vexierbilder entstehen. Liebhaber scheinen hingegen eher Randerscheinungen zu bleiben, zumindest treten sie nicht ins literarische Rampenlicht. Hier geht es vor allem ums Frauenleben – bis hinab zu den schauderhaften Abgründen einer erlittenen Vergewaltigung.
Heidegger und Genazino, nahezu geisterhaft
Judiths Vater Leo brachte es realiter vom Waschmaschinen-Vertreter bis zum CDU-Landtagsabgeordneten. In diesem Zusammenhang ist die kleine Judith einmal mit Franz Josef Strauß fotografiert worden. Als Kind mit ihren Eltern im Schwarzwald-Urlaub, sieht sie aus der Ferne schemen- und geisterhaft den steinalten Martin Heidegger, natürlich ohne Näheres über ihn zu wissen. Später haben u. a. der Schriftsteller Wilhelm Genazino und der Polyhistor Alexander Kluge ihre kurzen Auftritte, wobei Genazinos Part seltsam gespenstisch anmutet.
Und die große Historie, die Welt der Nachrichten? Seitdem die Autorin in Berlin lebt (wo sie anfangs Filmkritikerin beim „Tagesspiegel“ war), ergeben sich Geschichts-Ablagerungen wie von selbst, nicht zuletzt durch Erlebnisse des Zeitenwandels beim Transit in die DDR anno 1976, 1983, 1986 und dann nach der „Wende“. Damit können Schwelm oder Dortmund (wo die Autorin so manchen Kindheitssommer verbracht hat) denn doch nicht mithalten.
Schließlich finden sich solche Zitate, die man sich einfach zum Nachsinnen notieren sollte, um bald einmal darauf zurückzukommen: „Sie ist darauf gefasst, dass das Unglück so selbstverständlich ist wie der Tod und keine Sprache hat.“ – „Wir sitzen zu dritt in unserer Kindheit herum…“ – Oder jene (wiederum im lyrischen Zeilenfall aufscheinenden) aphoristischen Schlussworte:
Nicht wichtig
ist
was man aus uns gemacht hat
wichtig ist
was wir aus dem machen
was man
aus uns gemacht hat.
Judith Kuckart: „Die Welt zwischen den Nachrichten“. Roman. DuMont- Verlag, Köln. 190 Seiten, mit ca. 25 Schwarzweiß-Fotos. 24 Euro.