Ballonfahrt, Boheme und untröstliche Trauer: Julian Barnes‘ Buch „Lebensstufen“
Der Name der ebenso ruhmreichen wie exzentrischen Schauspielerin Sarah Bernhardt ist Kultursinnigen ja bereits öfter begegnet. Aber wer hat schon von den Herren Burnaby und Tournachon gehört?
Um ein Rätsel gleich zu lösen: Es handelt sich um zwei passionierte Pioniere des Ballonfahrens nach 1860. Noch viel schöner klingt freilich die Bezeichnung Aeronauten. Da spürt man mehr als nur einen Hauch von Zukunft und großem Versprechen.
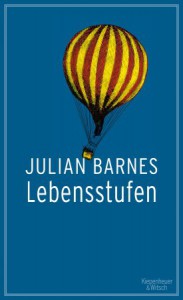 Mit dieser Zeit vormals ungeahnter, allerdings stets gefährdeter Freiheit in luftiger Höhe beginnt Julian Barnes sein Buch „Lebensstufen“, das später in andere Gefilde driften wird.
Mit dieser Zeit vormals ungeahnter, allerdings stets gefährdeter Freiheit in luftiger Höhe beginnt Julian Barnes sein Buch „Lebensstufen“, das später in andere Gefilde driften wird.
Am kulturgeschichtlichen Horizont jener Jahre leuchten große Namen auf: Jules Verne, George Sand, Victor Hugo, Odilon Redon und Nadar (alias Felix Tournachon), der nicht nur die frühesten Luftfotografien anfertigte, sondern auch unvergleichliche Porträts der eingangs erwähnten Sarah Bernhardt aufnahm.
Zeit der ungeahnten Freiheit
Da hängt also manches mit manchem zusammen, die Aeronauten etwa mit der Fotografie und den Bohemiens der Zeit, die sich ebenfalls ungeahnte Freiheiten nehmen und gleichsam Gott herausfordern. Das erste von drei Kapiteln trägt denn auch den Titel „Die Sünde der Höhe“…
Der Maler Odilon Redon hatte damals auch schon die Vision einer allmächtigen Überwachung aus den Lüften, als er ein bedrohliches Auge am Himmel schweben ließ. Ein Bild, wie für uns Heutige geschaffen.
Kommen zwei Menschen zusammen, so geschieht oft nichts Nennenswertes, zuweilen aber ändert sich das Gefüge der Welt und man darf die beiden eigentlich nie mehr trennen – so eine Denkfigur von Julian Barnes. Im zweiten Kapitel („Auf ebenen Bahnen“) schildert er die kurze, sehr ungleiche und glücklose Liebesgeschichte zwischen Colonel Fred Burnaby und der Männersammlerin Sarah Bernhardt.
Plötzliche Erschütterung
Damit wären wir also schon im weiten Reich des Zwischenmenschlichen angelangt. Doch geradezu schockhaft beginnt der dritte Teil, welcher da heißt: „Der Verlust der Tiefe“.
Barnes, der bislang über Historisches geläufig und unterhaltsam zu plaudern schien, nimmt auf einmal eine ganz andere Haltung zu den Lesern und somit zur Welt ein: Sein Buch, das zuvor in geschichtlicher Ferne zu schweben schien, allerdings nach und nach dringlicher wurde, ist nun noch weitaus unmittelbarer, ungleich erschütternder. Barnes spricht davon, wie er sich seit dem unendlich schmerzlichen Tod seiner Frau Pat Kavanagh am Leben gehalten hat. Seither gibt es keine „ebenen Bahnen“ mehr…
Julian Barnes war 30 Jahre mit seiner Frau zusammen, von seinen frühen Dreißigern bis ins 63. Lebensjahr. Sie wurde 2008 geradewegs aus dem Leben gerissen, zwischen Diagnose und Tod sind nur 37 Tage verstrichen. Der Autor berichtet von teilweise unbegreiflich läppischen oder fühllosen Reaktion der Mitwelt, auch von Freunden, die es daher nicht mehr sind. Dabei hätte er doch auch sie als verlässliche Zeugen des eigenen (Weiter)-Lebens gebraucht.
Vom Schwinden jeder Gewissheit
Rückbezogen wird der unfassbare Tod auf die vorherigen Ballonfahrt-Episoden. Vom Verlust der Höhen- und Tiefendimension im Dasein ist die übertragene und buchstäbliche Rede, vom Schwinden aller gewohnten Muster und des Sinns, also auch von Selbstmordgedanken.
Eine direkte Notwendigkeit, dies alles mit den frühen Ballonfahrten zu verknüpfen, erschließt sich nicht unbedingt sofort. Doch vielleicht ist gerade dies ein verzweifelter Akt der Sinnfindung und der Konstruktion eines neuen Zusammenhangs, eines Lebensrahmens. Eventuell verbirgt sich da irgendwo eine Art Gleichung, die aufgeht und neue Wege weist.
Julian Barnes erwägt die Möglichkeiten, mit dem Tod des geliebten Menschen – nein, nicht „fertig“ zu werden, aber ihn zu ertragen und trotz allem Quellen der Linderung zu finden, ob nun in der ungeheuren Gefühlshöhe mancher Opern (Glucks „Orpheus und Eurydike“), im Traum oder sonstwo. Oder gar in der Banalität des Sports im Fernsehen. Egal. Jeder Strohhalm wird ergriffen. Doch wer wagt es, von Trost zu reden?
Sex, Liebe und Leid
Die im Titel genannten „Lebensstufen“ (im Original „Levels of Life“) entsprechen laut Barnes den Wendekreisen der Biographie: Zuerst geht es darum, wer schon Sex hatte und wer nicht. Dann geht es um die Erfahrung der Liebe, schließlich um die Erfahrung des Leids.
Tiefen und Untiefen dieses Leids möglichst genau auszuloten – wenn das keine lebenswichtige Aufgabe ist! Und wer weiß: Vielleicht erfasst den Ballonfahrer oder auch den Leidenden ja doch eine Brise, die ihn in andere Breiten trägt?
Julian Barnes: „Lebensstufen“. Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Verlag Kiepenheuer & Witsch. 143 Seiten. 16,99 €.



