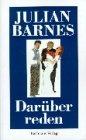Das Leben der Maler: „Kunst sehen“ von Julian Barnes
Durchs Coronavirus sind bekanntlich nicht nur alle Bühnenkünste stillgelegt, auch die Museen und Bildungseinrichtungen sind geschlossen. Uns bleiben aber – mehr denn je! – die Bücher. Daher an dieser Stelle nun öfter dieser oder jener Lesehinweis.
Julian Barnes befasst sich in seinem neuen Buch mit Kunst und – vor allem – mit den Künstlern. Der spannendste Text seines Bandes „Kunst sehen“ handelt von Théodore Géricault und seinem Gemälde „Das Floß der Medusa“. Er leitet (nach einem Vorwort) diesen Band ein und trägt hier den Titel „Aus Katastrophen Kunst machen“. Barnes-Leser kennen ihn bereits als Bestandteil des Romans „Eine Geschichte der Welt in 10 1/2 Kapiteln“. Dieser Auszug besteht auch für sich genommen, unabhängig vom Roman. In der Beschreibung des Bildes und seiner vielfältigen Beweggründe scheint nach und nach die gesamte Conditio humana auf. Ein großartiges Stück, das ein großartiges Gemälde aufschlüsselt, aber natürlich nicht völlig „erklären“ kann (was auch gar nicht der Anspruch ist)!
Ein wahrhaft furioser Text, der so gar nicht wichtigtuerisch oder gravitätisch daherkommt. Julian Barnes hat ja auch schon im Vorwort bekannt, dass er im Alter von 12 Jahren noch ein wahrhaftiger Banause gewesen sei, ohne jeden bildungsbürgerlichen Hintergrund, folglich auch ohne Dünkel. Erst ganz allmählich habe er sich den Künsten genähert, anfangs gleichsam von den Rändern her, als einsamer Besucher in eher schäbigen französischen Provinzmuseen. Vielleicht auch von daher sein angenehm unaufgeregter, unaufdringlicher „Plauderton“, der freilich auch ein angelsächsisches Erbteil sein mag.
Nun ist auch der Rest des Buches mancher Ehren wert. Und doch schien mir, als hätte ich mit den ersten Beiträgen schon das Allerbeste gelesen. Die weiteren Kapitel des Sammelbandes sind vorwiegend zuerst in Zeitungsbeilagen und Zeitschriften der Edelsorte erschienen – beispielsweise „Modern Painters“, „Times Literary Supplement“ oder „New York Review of Books“. Sie behandeln Werke und Werkabschnitte von Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Vallotton, Magritte und anderen. Der Schwerpunkt liegt also eindeutig auf der französischen Kunst und dort wiederum auf der der Klassischen Moderne.
Man lernt auf jeden Fall einiges hinzu. Um nur wenige Stichpunkte zu nennen: Man erfährt vom erstaunlich krassen Gegensatz eines ausgesprochen ruhigen Lebens und einer exzessiven Kunstausübung bei Delacroix. Courbet wird als monströser Selbstvermarkter plastisch dargestellt, der neben sich allenfalls noch Victor Hugo gelten ließ. Odilon Redon hingegen, ein Vorläufer des Surrealismus, sei (entgegen allen Klischees und den Gepflogenheiten der Bohème) ein glücklich verheirateter Mann gewesen…
Man ahnt vielleicht schon den möglichen Schwachpunkt: Julian Barnes konzentriert sich oft gar nicht mehr so sehr auf die Werke, sondern auf deren Urheber; speziell darauf, wie so ein Künstlerleben verlaufen kann, ja, was eine Künstlerexistenz recht eigentlich ausmacht – wobei er natürlich auch sein eigenes Dasein als Schriftsteller stets mitbedenkt. Und so gerät er vielfach in Versuchung, beim Biographischen, ja mitunter auch beim Anekdotischen zu verharren.
Keine vollkommen ungetrübte Empfehlung also. Aber doch ein Buch, mit dem man gewiss keine kostbare Lebenszeit verschwendet.
Julian Barnes: „Kunst sehen“. Aus dem Englischen von Gertraude Krueger und Thomas Bodmer. Kiepenheuer & Witsch. 352 Seiten, 25 Euro.