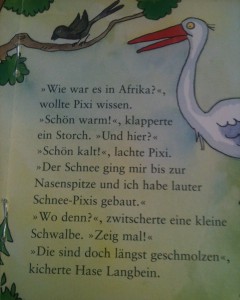„Freundin der Kinder“ – die Hammer Autorin Ilse Bintig
Gastautor Heinrich Peuckmann erinnert an die Kinder- und Jugendbuchautorin Ilse Bintig aus Hamm:
„Wenn ich erst mal pensioniert bin, schreibe ich ein Buch.“ Das ist ein Satz, den man als Autor gelegentlich von ambitionierten Menschen hören kann, und es ist besser, nicht darauf zu antworten. Warum sollte man jemandem seine Hoffnungen nehmen? Denn nach allen Erfahrungen gilt, dass man im Alter nicht etwas neu beginnen kann, was man vorher nicht geübt hat.
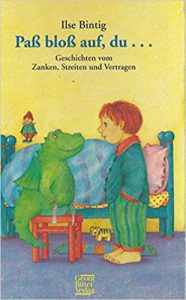 Und doch gibt es Ausnahmen. Die Hammer Kinder- und Jugendbuchautorin Ilse Bintig ist wohl die erfolgreichste, die dem Erfahrungssatz widerspricht. Ilse Bintig hat im Grunde zwei Leben gelebt. Zuerst das Leben als Ehefrau, Mutter und Lehrerin. Erst spät hat sie ihren Sohn Holger bekommen und ihre ganze Aufmerksamkeit galt fortan dem Wunschkind. Daneben war sie an einer Grund- und später einer Hauptschule eine engagierte Lehrerin, die ihre Arbeit mit großem Ernst und großer Freude erledigte, so dass für eine Nebentätigkeit keine Zeit blieb.
Und doch gibt es Ausnahmen. Die Hammer Kinder- und Jugendbuchautorin Ilse Bintig ist wohl die erfolgreichste, die dem Erfahrungssatz widerspricht. Ilse Bintig hat im Grunde zwei Leben gelebt. Zuerst das Leben als Ehefrau, Mutter und Lehrerin. Erst spät hat sie ihren Sohn Holger bekommen und ihre ganze Aufmerksamkeit galt fortan dem Wunschkind. Daneben war sie an einer Grund- und später einer Hauptschule eine engagierte Lehrerin, die ihre Arbeit mit großem Ernst und großer Freude erledigte, so dass für eine Nebentätigkeit keine Zeit blieb.
Den heimlichen Wunsch zu schreiben, hat sie in dieser Zeit nicht ausgelebt, aber er war da, schon seit Jugendzeit. Ilse Bintig wollte nämlich eigentlich gar nicht Lehrerin werden, Journalismus, das war ihr Traumberuf. Aber nach dem Abitur 1943 gab es keine Möglichkeit, dies zu studieren. Erst zwei Jahre nach Kriegsende bekam sie einen Studienplatz für Pädagogik. Und wenn es auch nicht ihr Traumberuf war, Lehrerin zu werden, Ilse Bintig ist es trotzdem gerne gewesen. Ihre Schüler, die sich bis zu ihrem Tod bei ihr meldeten, haben es ihr gedankt.
Zweites Leben nach der Pensionierung
Aber Ilse Bintig war zäh. Zäh im Verfolgen ihrer Ziele, gerade auch des heimlichen Ziels. In der Schule übernahm sie die Bücherei, und sie hat nicht einfach nur Bücher bestellt, von denen sie hörte, dass sie gut seien. Ilse Bintig hat sie fast alle gelesen. Sie wusste also, als sie 1984, mit sechzig Jahren, pensioniert wurde, welche Themen Kinder und Jugendliche interessieren, wie man eine Geschichte spannend aufbaut und vor allem wie man sie so erzählt, dass sich junge Menschen angesprochen fühlen.
Frei gelassen von den Pflichten ihres ersten Lebens, legte Ilse Bintig dann in einem Schreibtempo los, das lange seinesgleichen sucht. Kinderbuch auf Kinderbuch erschien. Und gleichzeitig brachte sie sich in die Literaturszene ein, wurde Mitglied im Schriftstellerverband, unterstützte Initiativen zur Literaturförderung und war maßgeblich an der Gründung des Westfälischen Literaturbüros in Unna beteiligt.
Beste Zeit beim Bitter-Verlag in Recklinghausen
Zuerst veröffentlichte sie im Kölner Pick-Verlag, dann wechselte sie zum damals sehr erfolgreichen Bitter-Verlag nach Recklinghausen und ihre beste Zeit begann. Man tut wohl niemandem Unrecht, wenn man sagt, dass Ilse Bintig neben Josef Reding viele Jahre lang erfolgreichste Autorin des Bitter-Verlags gewesen ist. Bücher wie „Paß bloß auf, du … Geschichten vom Zanken, Streiten und Vertragen“ sowie „Dominik und Löwenmähne. Geschichten von Liebe, Wut und anderen Gefühlen“ entstanden. Aber sie griff auch in ihre eigene Kindheit zurück und schrieb „Die Leierkastenfrau. Uroma erzählt von früher.“
Ilse Bintig folgte in ihrer Konzeption nicht der modischen Meinung mancher Kinderbuchautoren, dass Kinderliteratur völlig frei sei, dass sie keinem Auftrag folge und damit letztlich anzusehen sei wie all die übrige Literatur. Als Lehrerin, die sie über 30 Jahre lang gewesen ist, wusste sie es besser. Kinder brauchen liebevolle Zuwendung, sie brauchen Hilfestellung, um ihren Weg ins Leben zu finden und manchmal brauchen sie einfach nur einen guten Anlass, um laut loslachen zu können. Deshalb hatte sie nichts dagegen, dass eines ihrer Bücher den Untertitel „Mutmachgeschichten“ erhielt, der die Absicht verriet, die mit dem Buch verfolgt wurde.
Bloß keine Zeit mit Zank verschwenden
Ilse Bintig wusste, dass nicht der Untertitel wichtig war, sondern dass es auf etwas ganz anderes ankam. Pralle Charaktere mussten ihre Geschichten enthalten, spannende und lustige Abenteuer mussten ihre kleinen Helden erleben und dabei – ohne pädagogisch zu werden – etwas über das Leben erfahren, über seine düsteren, vor allem aber über seine angenehmen Seiten. Das Leben ist schön, das ist es, was ihre Geschichten verraten. Weshalb sollten die Kinder sich deshalb die Zeit mit Zanken vergällen, sie machten sich das Leben nur unnötig schwer. Besser sollten sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen und vor allem sollten sie optimistisch in die Welt der Erwachsenen eintreten.
Ab 1984 erschien von Ilse Bintig mindestens ein Buch pro Jahr, oft waren es zwei oder sogar drei. Es war so, als hätte sie ihr Leben lang Ideen gesammelt und nur auf die Zeit gewartet, in der sie alle niederschreiben konnte. In dieser Zeit hat Ilse Bintig viele Lesungen gehalten, war unter Grundschullehrern eine Autorengröße, die man gerne einlud. Ilse Bintig hat diese Lesungen, die sie trotz ihres doch schon hohen Alters mit Bravour meisterte, dazu benutzt, um die Stimmung der Kinder aufzunehmen. Um dabei zu lernen, was die Kinder interessierte und was sie folglich in ihrem nächsten Kinderbuch thematisieren sollte.
Der Flieger Hanno war ihre Jugendliebe
Aber es waren nicht nur Kinderbücher, die sie schrieb. Zwei Jugendbücher, die auch Erwachsene gut lesen können, ragen unter ihren gut 40 eigenständigen Werken heraus. In „Lieber Hanno“, einem Briefroman, thematisiert Ilse Bintig ihre eigene, erste große Liebe. Im Grunde besteht der Roman aus den Briefen, die sie bis Juli 1944 an ihre Jugendliebe schrieb, an Hanno, den Flieger, der abgeschossen wurde und nie zu ihr zurückkam.
Ein Freund von Hanno hat ihr die eigenen Briefe nach dem Tod des Fliegers zurück geschickt, als Autorin hat Ilse Bintig sie in die richtige Reihenfolge gebracht und mit den Briefen ihres Freundes kombiniert. Ein tief beeindruckendes Buch ist auf diese Weise entstanden, das von den Hoffnungen erzählt, die zwei junge Menschen an das Leben hatten und die brutal zerstört wurden. Es ist ein Buch, das zum Frieden mahnt, indem es die schreckliche Seite des Krieges unverblümt darstellt. Da wurden Hoffnungen zerstört, wurde ein Leben abgebrochen und mit ihm eine Liebe. Was hätte werden können, was alles wäre möglich gewesen? In der Folge dieses Buches hat Ilse Bintig sich mehrfach mit Antoine de Saint-Exupery beschäftigt, der ja auch ein begeisterter Flieger war und der ebenfalls im Krieg sein Leben lassen musste. Zum „Kleinen Prinzen“ hat sie eine Ergänzungsgeschichte geschrieben.
„Trümmer und Träume“: Frage nach Mitschuld der Mutter
Ihr zweites wichtiges Jugendbuch „Trümmer und Träume“ ist ebenfalls stark autobiographisch geprägt. Ilse Bintigs Mutter war im Krieg bei der NS-Frauenschaft tätig. Eher unbedacht und aus Pflichtgefühl ist sie da hineingeraten, wurde nach dem Krieg als „Mittäterin“ eingestuft und inhaftiert. Aus der Sicht der Tochter, also aus Ilse Bintigs eigener Sicht, wird nun der Verlust der Mutter und der Versuch, sie aus dem Lager frei zu bekommen, dargestellt. Die Sicht der Tochter auf die Mutter ist natürlich die des liebenden Kindes, das unter dem Verlust leidet. Sie umkreist die Frage nach der Schuld. Wie viel ist der Mutter anzulasten, wie ist sie da hineingeraten? Die Geschichte ist authentisch, sie ist spannend und sie zeigt, wie die Kleinen die Suppe auszulöffeln hatten, während die Großen, die sie eingebrockt hatten, oft genug ungeschoren davon kamen.
Gelegentlich wurde Ilse Bintig bei Lesungen der Vorwurf gemacht, den Faschismus zu verharmlosen, aber das war ein ganz und gar unberechtigter Vorwurf. Es ging ihr schon um die Rehabilitierung ihrer Mutter, das merkt man beim Lesen des Buches, aber eine Verharmlosung, gar Verklärung des Faschismus, ist das Buch auf keinen Fall. Im Gegenteil, es zeigt, wie die Tochter all die falschen Vorstellungen, die ihr im Umfeld, in der Schule eingehämmert wurden, nach und nach mit Einrücken der Alliierten und dem Ende des Krieges verliert und wie sie Klarheit gewinnt für eine Zukunft in Demokratie.
Ein Stück Sozialgeschichte des Ruhrgebiets
Völlig zurecht wurde „Trümmer und Träume“ Buch des Monats bei der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Eine Auszeichnung, über die Ilse Bintig sich sehr gefreut hat. Auszeichnungen bekam sie noch 1989 bei einem Schreibwettbewerb des WDR, bei dem sie den ersten Preis belegte, dazu erhielt sie 1990 den „Alfred-Müller-Felsenburg-Preis“.
Etwas unbeachtet blieb ihr Buch für Erwachsene. „Zwischen Fördertürmen und Fabrikschornsteinen“ heißt es und schildert ihre Jugend in Hamm. In sehr lebendig erzählten Erinnerungen wird hier ein Stück Sozialgeschichte des Ruhrgebiets sichtbar. Vielleicht war es die Begrenzung auf Hamm, die ein größeres Interesse ausbleiben ließ, was aber, wenn es so wäre, falsch ist. Gerade am Konkreten, am Lokalen, schimmert viel Allgemeingültiges durch.
Viele Kinderklassiker nacherzählt
In ihren letzten Jahren erzählte Ilse Bintig für den Arena-Verlag Kinderklassiker nach. „Nussknacker und Mausekönig“ von E.T.A. Hoffmann, „Peter Pan“, „Nils Holgerson“, „Die Schatzinsel“, „Till Eulenspiegel“ und viele andere Klassiker hat sie nacherzählt. Der Verlag wusste, warum er sie, inzwischen schon weit über achtzig Jahre alt, immer wieder ansprach, wenn ein weiterer Klassiker neu erzählt werden sollte. Ilse Bintig fiel es leicht, sich in Themen und Schreibweisen einzufühlen. Die von ihr erzählten Klassiker erreichten hohe Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt.
Meine „Büchskes“ nannte Ilse Bintig diese schön aufgemachten Bücher. Wenn ihr nach und nach die Kraft für eigene Bücher verloren ging, so hat das Nacherzählen der Klassiker sie jung gehalten und nach Krankheiten, die sich häuften, immer wieder neue Kraft fürs Leben gegeben. Diese Kraft gaben ihr auch ihr beiden Enkel, Anna und Hauke, die sie spät zur Oma werden ließen. Zu einer Oma, die diese Aufgabe wieder mit der ihr eigenen großen Freude und Liebe anging.
90 Jahre alt ist Ilse Bintig geworden. Ihren 90. Geburtstag, von der Stadt Hamm stark beachtet, hat sie noch begehen können. Nur 5 Tage später, am 12. April 2014, ist sie friedlich eingeschlafen. „Als Mutter, Großmutter, Lehrerin und Autorin war sie eine Freundin der Kinder“ stand in der Todesanzeige. Besser konnte man es nicht ausdrücken.