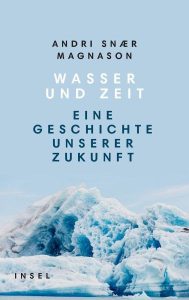Die Rettung des Planeten kann auch aus Poesie erwachsen: Andri Snær Magnasons aufrüttelndes Buch „Wasser und Zeit“
Wenn ein Thema dieser Zeit global und entsetzlich entgrenzt genannt werden kann, dann das wohl dringlichste überhaupt: der Klimawandel. Es ist denn auch viel mehr als ein „Thema“ unter anderen, es geht ja um die ganze Existenz des Planeten und unseres Daseins.
So darf es auch nicht verwundern, dass der isländische Autor Andri Snær Magnason für sein streckenweise aufrüttelndes Buch eine geradezu verwegene Mixtur anrührt, indem er beispielsweise vorzeitlichen und immer noch nachwirkenden Bezügen zwischen seiner karstigen Heimat und dem Himalaya nachspürt. Dermaßen auffällig erscheinen ihm landschaftliche, spirituelle und mystische Querverweise, dass es kein Zufall mehr sein könne, sondern höherer und tieferer Sinn darin liegen müsse, der jede dürre Schulweisheit übersteigt oder jedenfalls überhöht. Nicht nur mit Daten, sondern auch und vor allem mit Dichtung lasse sich vor Augen führen, wie schön das Verlorene war und wie ernst die jetzige Situation ist.
„Mit Gottes stillegeschwängerter Kosmosweite“
Der ungemein vielseitige Schriftsteller Magnason (Kinderbücher, Theaterstücke, Lyrik, Romane, Sachbücher), der auch schon mal bei der Präsidentschaftswahl seines Landes kandidiert hat, findet, dass wir noch gar keine adäquate Sprache gefunden haben für die drohenden Katastrophen, die ihn wiederum an die altisländischen Vorstellungen vom Ragnarök (Weltuntergang) gemahnen. Elemente der geistesgeschichtlich überlieferten „Romantik“, Naturanbetung und beseeltes Erzählen scheinen nach seiner Ansicht hierbei entschieden weiter zu führen als nur rationale Betrachtungen oder prognostische Berechnungen. In poetischer Diktion wird ein Gletscher-Erlebnis vollends überwältigend, so heißt es etwa in einem Text des Romantikers Helgi Valtysson: „Und dein Selbst verschmilzt wie eine bebend erklingende Saite mit Gottes stillegeschwängerter Kosmosweite…“ Für Magnason ist es keine Frage mehr, dass dieses Gefühl und seine natürliche Grundlage bewahrenswert sind. Freilich ließe sich das alles auch als Esoterik denunzieren, aber es gibt ungleich Wichtigeres zu tun.
Nach einer passenden Sprache suchen
Traditionelle isländische Sprechgesänge, noch von den Großeltern des Autors überliefert, korrespondieren mit einer damals noch recht intakten Natur, vor allem mit den mächtigen Gletschern, die nun längst dahinschmelzen; ein höchst beunruhigendes Phänomen, das abermals auf die Himalaya-Region bezogen wird, wo das Leben vieler Millionen Menschen vom alljährlichen Zyklus des Gletscherwassers abhängt. Wasser und Zeit…
An einem etwas anders gelagerten Beispiel sucht Magnason zu erläutern, wie Menschen ihre Lage gar nicht begreifen können, wenn sie keine passenden Worte für akute Zustände haben. So habe schon um 1809 der dänische Abenteurer Jørgen Jørgensen den Isländern erzdemokratische Freiheitswerte und Unabhängigkeit gepredigt, doch das Volk habe überhaupt nicht gewusst, wovon er da redete – und sei der dänischen Fremdherrschaft hörig geblieben.
„Jedes Leben ist eine Lebensaufgabe“
Das Buch führt in die Frühzeit der isländischen Gletscherforschung in den 1930er Jahren, die wiederum verwoben wird mit der Familiengeschichte des Autors, welche auch in andere Bereiche ausgreift. Wer kann schon von sich sagen, dass ein Großvater in die USA ausgewandert ist und dort als Arzt sowohl den Schah von Persien als auch Andy Warhol operiert hat? Wer kann mit Fug behaupten, ein Onkel sei weltweit ein Pionier bei der Rettung nahezu ausgerotteter Krokodile gewesen? Wie heißt es doch auf Seite 139 so allgemeingültig: „Jedes Leben ist eine Lebensaufgabe…“
Was einem zwischendurch wie bloße Abschweifung erscheinen mag, markiert in Wahrheit wohl die Spannweite der möglichen und (prinzipiell jedem zugänglichen) Lebenserfahrung, die eben potentiell auch rückwärts bis zu den Vorfahren und vorwärts bis zu Kindern und Enkeln reicht. Auch schon vor ergänzender Lektüre begründet dies eine Verantwortlichkeit für den Zustand der Welt. Die fassbare Dimension der Zeit umgreift mehr als das eigene Leben. Diese Einsicht bewirkt, dass man über sich und seine Generation hinausdenkt; dass man gewahr wird, wie sehr die Erde sich seit den Ahnen geändert hat, welche Verluste bereits eingetreten sind. Das Schicksal der Erde dreht sich derweil nicht mehr um zigtausend Jahre, es steht – so der glaubhaft erschreckende Befund – Jahr um Jahr mehr auf dem Spiel, ist vielleicht schon bald unwiderruflich besiegelt.
Welch eine Bürde für die Nachgeborenen!
Von immer neuen Seiten beleuchtet der Autor die gigantische Bedrohung. Gelegentlich scheint das Buch thematisch etwas auszufransen, doch nimmt es auch immer wieder die Hauptspur auf. Der Zufall (oder die Fügung?) wollte es, dass Magnason mehrfach Gespräche mit dem Dalai Lama führen durfte, dessen Weisheit in allen Dingen mit staunenswerter Zuversicht einhergeht, wie denn überhaupt gegen Schluss des Bandes einige Entwicklungen und Forschungen anklingen, in denen Lösungsansätze stecken könnten. Doch es geht eben nicht nur um Forschung, sondern zuallererst um Haltung und Entschlusskraft. Und Magnason ist überzeugt: Die jetzt heranwachsende ist die letzte Generation, die die Erde retten kann. Welch eine Bürde!
Andri Snær Magnason: „Wasser und Zeit. Eine Geschichte unserer Zukunft“. Aus dem Isländischen von Tina Flecken. Insel Verlag, 304 Seiten, 24 Euro.