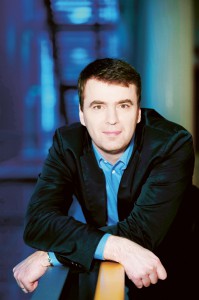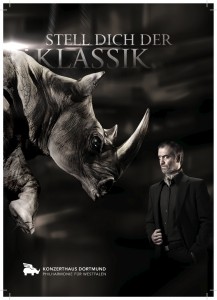Langer Abschied vom Generalmusikdirektor: Gabriel Feltz wechselt bald von Dortmund nach Kiel

Hat bald einen neuen Arbeitgeber: Dortmunds Generalmusikdirektor Gabriel Feltz. (Foto: Andy Spyra/Dortmunder-Philharmoniker)
Einmal noch – dann ist es vorbei: Das (gut bemessene) Jahrzehnt, in dem Generalmusikdirektor (GMD) Gabriel Feltz ausschließlich in Dortmund – und als Chefdirigent in Belgrad – den Taktstock hob. Er geht nach Kiel. In der kommenden Spielzeit werden Dortmund und Kiel sich, wenn man einmal so sagen darf, den Generalmusikdirektor Feltz teilen, und dann ist er weg. Somit ist es wohl ein Abschied auf Raten, der eigentlich in dieser Spielzeit schon begonnen hat – mit einer Art Ruhrgebiets-Programm als dankbarer Verbeugung vor einem alles in allem doch sehr treuen Konzerthauspublikum.
Nun ging das achte philharmonische Konzert der laufenden Spielzeit, umjubelt natürlich, über die Bühne; Nummer neun wird ein Gast (Howard Griffith) leiten, Nummer 10 schließlich, „Wunschkonzert“ betitelt und in der Tat als ein solches konzipiert, wird dann der letzte philharmonische Auftritt von GMD Gabriel Feltz in dieser Saison sein. Und man hat das Gefühl, daß da etwas zu Ende geht, was nicht zwingend eine gleichwertige Fortsetzung erfahren wird.
So gut haben die Dortmunder noch nie gespielt
Fraglos nämlich muß man konzedieren, daß diese zehn Jahre Feltz das Dortmunder Orchester in qualitative Höhen brachten, die ihm vorher eher fremd waren. Er hatte gute Vorgänger, gewiß, stammten sie nun aus Holland oder den USA. Aber die Präzision des gebürtigen Berliners erreichten sie nicht. Über seinen Führungsstil gab es wenig Gerede, sein Auftreten wirkte – aber das ist nur aus dem Parkett heraus gesprochen – eher kollegial. Dieser (unterstellte) Führungsstil mag ausschlaggebend dafür gewesen sein, daß Feltz schließlich zum neuen GMD in Kiel gewählt wurde, auch mit den Stimmen der dortigen Orchestermusiker. Wie ein großer Karrieresprung kommt einem der Wechsel nach Kiel eigentlich nicht vor. Na gut, Landeshauptstadt; der Mann wird seine Gründe haben.
Revierthemen
Das Programm der nun bald endenden letzten Spielzeit trug nicht wenig dazu bei, der Sympathiekurve des Dirigenten noch mal einen kräftigen Schub nach oben zu geben. Jedes Mal ging es um Revierthemen oder doch wenigstens um reviernahe Themen – mit Überschriften wie „Stahlkocher“, „Taubenzüchter“ oder „Im Schrebergarten“. Naturgemäß blieb die Musikauswahl manchmal etwas bemüht. Dvorak etwa erklang am Taubenzüchter-Abend, weil Dvorak selbst ein leidenschaftlicher Taubenzüchter gewesen sein soll. Das mußte als Begründung reichen, denn seine Neunte „Aus der Neuen Welt“, die zur Aufführung gelangte, hat ja eher wenig mit dem Revier zu tun.
Grandiose Koloratursopranistin
Am letzten 8. Abend nun, „Mensch und Maschine“ überschrieben, blieb die Schere zwischen Motto und Stücke-Auswahl, aber auch zwischen den einzelnen Stücken, erstaunlich eng geschlossen – erstaunlich, weil eine Abfolge von Johann Strauß (Sohn), Gershwin, Ligeti und Beethoven nicht unbedingt auf klangliche oder emotionale Verwandtschaft schließen läßt. Doch gerade György Ligetis „Mysteries of the Macabre“, ein aufgewühltes Gesangsstück, hervorgegangen aus der einzigen Oper des Komponisten „Le Grand Macabre“ und vorgetragen, gesungen, geschrieen von der Koloratursopranistin Gloria Rehm, zeigte unerwartete Kongenialität; einen gewissen Beitrag zur Wirkmächtigkeit des Vortrags leisteten sicherlich auch der hautenge, mit Elektronikplatinenmuster bedruckte Body der Sängerin und ihre absichtsvoll sicherlich prolligen silbernen Stiefel. Einen ganzen Abend lang möchte man das vielleicht nicht hören, das würde zu anstrengend; aber die neun Minuten (die Dortmunder Programmhefte nennen seit einiger Zeit die Dauer der Stücke), die nun zur Aufführung gelangten, waren grandios und rissen das Publikum am Schluß zu spontanen Stehovationen aus den Sesseln. Gern akzeptierte man dabei die Humoranwandlung des Dirigenten, der irgendwann zwischendurch mal fragte, ob die Sängerin denn nichts auf Deutsch zu singen habe. Wäre nicht nötig gewesen, aber egal.
Spaß muß sein
Strauß’ „Perpetuum mobile“, vom Komponisten selber schon als „musikalischer Scherz für Orchester“ bezeichnet, ist ein Endlos-Stück, das einen Dirigenten gar nicht braucht. Die Musiker schaffen das alleine. Wie aber bringt man sie dazu aufzuhören? Feltz, bald schon nicht mehr dirigierend, bat die Kapelle händeringend, bot Geld, suchte schließlich einen Menschen im Publikum, der es mit Hilfe eines Megafons irgendwie schaffte, für Ruhe zu sorgen. Na gut, Spaß muß sein.
A propos Spaß: Den angstschweißtreibenden Spaß einer Probefahrt in einem „sehr schicken italienischen Sportwagen“ setzte der Komponist John Adams (geb. 1947) „noch nicht vollständig erholt“ 1986 in ein bombastisches Klanggemälde mit dem Titel „Short Ride in a Fast Machine“ um. Diese vier Minuten standen am Beginn des Abends, und selten waren zur Geräuschentfaltung mehr Musiker auf engem Bühnenraum zusammengepfercht als bei diesem Vortrag.
Der unvergeßliche Borussia-Abend
A propos Spaß, die zweite: Einer der stärksten Abende der nun bald endenden Spielzeit war sicherlich „Faszination Stadion“, Mitte Januar. Als das fußballerischste (man entschuldige den ungelenken Superlativ) Stück des Abends erklang „You’ll Never Walk Alone“ (Richard Rodgers/Oscar Hammerstein), samt Aufforderung an die zahlreich schwarz-gelb gewandeten Besucher, mitzusingen. Dortmunds Homeboy Nobby Dickel erzählte noch einmal von seinen berühmten Toren, Dr. Michael Stille, Orchesterdirektor seines Zeichens, moderierte gut gelaunt und kenntnisreich. (Allerdings dirigierte an diesem Abend nicht Feltz, sondern Martijn Dendievel.) Die Frau jedenfalls auf dem Nachbarplatz, die schon oft im Stadion, aber noch nie im Konzerthaus gewesen war, fand das alles toll. Auch die Musik von Schostakowitsch. Und man konnte durchaus den Eindruck haben, daß viele weitere Borussen das Konzerthaus einfach gut fanden, und viel weniger elitär als befürchtet.
Das Konzerthaus ist voll
Unter Feltz’ Leitung haben die Philharmoniker die Corona-Jahre gut überstanden, die Hütte war in dieser Spielzeit wieder ziemlich voll, man sieht erfreulich viele jüngere Gesichter im Saal. Die Dortmunder Oper, so der Eindruck, tut sich deutlich schwerer, ihr Publikum zu finden. Produktionen wie (zuletzt) „Der schwarze Berg“ von der französischen Komponistin Augusta Holmès finden eher Beachtung in den überregionalen Feuilletons als beim heimischen Publikum, scheint es. Doch sei nicht dieses unser Thema.
Ein Nachfolger für Gabriel Feltz ist ausgeguckt und engagiert: Jordan de Souza, Kanadier, 1988 in Toronto geboren, heißt ab 2025 der neue Dortmunder GMD.