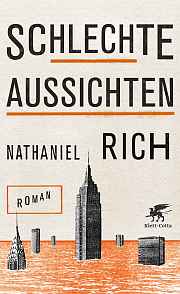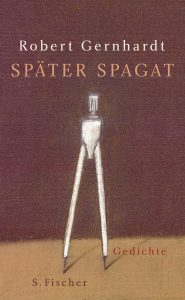Was ist ein „apallisches Durchgangssyndrom“? Dazu gibt es heute im Hospital eine Selbsthilfegruppe. Viel wissen, sich selbst zu helfen, zumindest kulinarisch. Draußen hält ein Pizzataxi. Ein riesiger Karton Pizzas und Colakisten werden ins Haus geschleppt. Vielleicht das Ergebnis der Ernährungsberatung?
Mein neuer Nachbar erhält eine Biopsie. Man schickt mich raus. Gott sei Dank, denn man will ja nicht mit schmerzenden fremden Körpern konfrontiert werden. Außerdem wartet eine solche Maßnahme auch auf mich. In meiner Arzneischatulle fehlt heute Morgen eine Tablette. Versehen oder der erste medizinische Fehler, der mich mein Leben kostet? Ich frage nach und man sagt mir in der Organisationszentrale der Abteilung, ich bekäme ja abends eine. Ich sage „Nein, morgens und abends“. Es sei nicht so wichtig, denn ich habe ja noch Tabletten aus dem eigenen Bestand.
Ein Namensschild – gottlob noch nicht am Zeh
Vor der Selbsteinlieferung hatte ich der Ärzteschaft eine Liste meiner einzunehmenden Medizin überreicht. Genaue Bezeichnung, Menge, Sinn und Zweck. Bei der Zimmeraufnahme fragte man mich dann, welche Medizin ich einnähme. Ist das ein Trick, um meine Zurechnungsfähigkeit zu testen? Ich deute auf den mitgebrachten Eigenbestand. Alles wird notiert. „Das bekommen Sie jetzt alles von uns. Bis auf Präparat I.“ Das hätten sie gerade nicht vorrätig.

Aussichten
Bei der Visite am dritten Tag fragt mich der Arzt, den ich zum ersten Mal sehe, welche Medikamente ich einnähme. Ich zähle alles auf und er notiert. Es wird viel notiert. Das beruhigt mich. Als hilflose Person würde mir wahrscheinlich irgendwas oder nichts verabreicht. Ich wiederhole meinen Namen, damit es keine Missverständnisse gibt.
Eine Untersuchung muss wiederholt werden wegen eines Computerfehlers. „Wann?“ frage ich. „Bald“ heißt die Antwort. Ich will raus. Die Sonne scheint. Am Fußende des Bettes klebt ein Namensschild, Gott sei Dank noch nicht an meinem Zeh. Das Wort „Frau“ ist durchgestrichen. Herr Dennemann, lese ich. Richtig. „Richtig. Das bin ich“, denke ich.
Nach dem Mittag wird es stiller im Gang. Das ist die Zeit, wo sich die Bösen ins Spital schmuggeln, sich einen Kittel klauen und wichtige Zeugen töten. Ich bin kein Zeuge. Vor meiner Tür sitzt kein dösender Polizist. Glocken läuten. Andacht für alle Glaubensrichtungen. Ich versuche zu dösen und versuche gleichzeitig, mich in einen Traum zu taumeln. Der Traum von einem Kloster, wo unentwegt Füße gewaschen werden.
Stille kann so nervös machen
Stille kann nervös machen. Die Nacht gelingt mir. Sie geht vorüber. Der Aufstand beginnt wieder um 5.50 Uhr mit einem Morgengruß. Ein hinkender Stationsarzt mit migrantischem Hintergrund kündigt die Punktierung des Rückens an. Für 13.30 Uhr. Ich lese die Belehrung, die er mir vorlegt und die darauf hinweist, dass ich möglicherweise dahingerafft werde, falls ich dieses eine Prozent bin. Er verspricht Schmerzfreiheit, ein kühner Bursche.
Das Mittagessen ist wieder akzeptabel, vor allem, weil ich Salzkartoffeln mit Gemüsebeilage mag; egal, welche Fleischbeigabe dazu noch in der Soße schwimmt. Das Hähnchen heute ist wie alle Hähnchen. Die Brühe ist mit ungewürztem Ei angedickt.
Gleich wird eine Hohlnadel in den Rücken gejagt. In gebückter Haltung werden mir Wässerchen entnommen. Der hinkende Arzt ist mir willkommen. In mancher Hinsicht ist er Außenseiter im Ärzteleben. Er wird keiner Krankenhausfußballmannschaft angehören. Und auch bei Golf und Tennis eher zuschauen. Vielleicht beschäftigt er sich auch in seiner Freizeit mit Krankheiten und forscht und forscht. In aller Ruhe zapft er bei mir ab, nachdem er mich vorher vereist hat. Teile von mir sind Polargebiet. Alles läuft gut. Ich solle zwei Stunden ruhen. Nach siebzig Minuten verhalte ich mich gegen den Befehl und renne ins Freie. Jetzt ist die Bettkante Wartepunkt für die irgendwann anstehende Muskeluntersuchung, auf die ich mich freue, habe ich doch selten direkt mit meinen Muskeln zu tun, zumindest nicht mit denen, die Kraft bedeuten. Kau- und ein paar andere Muskeln funktionieren tadellos.
Der Mann aus Libyen sitzt nachts im Flur
Im Foyer gibt es neue Ankündigungen. Man lädt zu einer Krabbelgruppe. Dafür käme ich mutmaßlich erst nach meiner Muskelbehandlung in Frage. Es regnet. Nebenan liegt ein Mann aus Libyen. Eingeflogen. Spricht Englisch. Arbeitet bei der UN. Die Neurologie habe einen guten Ruf bei der UN. Nachts sitzt er im Flur, da die Schlafgeräusche seines Bettnachbarn ihn an kriegerische Auseinandersetzungen erinnern.
Ich achte auf Schritte im Flur. Ob sie sich meinem Einzeldoppel nähern? Ich warte auf die Aufforderung zur angekündigten Untersuchung. Im Gefängnis sind das die Schritte, die das Ernährungsbrett in die Zelle schieben. Gegenüber vom Krankenhaus liegt eine Haftanstalt für Freigänger – wie ein unbewohntes Schloss. Die Insassen gehen zur Arbeit, machen ihre Pausen und kehren abends in die Zelle zurück, lesen, schlafen ein. Kein Doppeleinzel. Nein, ich will nicht tatsächlich tauschen. Hier kann ich jederzeit gehen, meinen Koffer packen und sagen: „Das Hotel gefällt mir nicht. Ich buche um.“
Auf der Wasserflasche steht „gutgesund“
Ich lese das Etikett meiner Wasserflasche und sehe das neue Wort „gutgesund“, also nicht gut und gesund, sondern schlicht gutgesund. Ich frage nach einer Falsche mittelgesund oder mediumgesund. Man blickt mich in der engen Teeküche an, wie man Störenfriede anschaut. Die Teeküche ist so klein, dass alle Vorstellungen von sexuellen Übergriffen des Stationsarztes mit der jungen Schwester ins Leere laufen. Wenn sich dort drei Personen gleichzeitig aufhalten, ist das automatisch schon sexuelle Belästigung – wie in den meisten Aufzügen dieser Welt. Da kann man noch so viele Beutel Pfefferminztee in den Händen haben. Das Stationszimmer, also die Stationsrezeption, das Zentrum der Abteilung, ist der Arbeitsraum für gefühlte elf Personen und man weiß nicht recht, wer Schwester, wer Pfleger, wer Arzt und wer möglicherweise der Vertreter der outgesourcten Ernährungsfirma ist.
Gespräche draußen vor der Tür
Eine mir bisher unbekannte Schwester betritt mein Zimmer, das ich jetzt Warteraum nenne. Eine neue Verkündigung? Nein, sie will zu einem Herrn Pütz, der ich nun mal nicht bin. „Wer sind Sie denn?“ fragt sie. „Darf ich mich vorstellen? Dennemann mein Name.“ „Dann nicht“, sagt sie und verirrt sich in der nächsten Tür.
Draußen vor der Tür finden weiter unentwegt Krankengespräche statt. Nach dem Frühstück oder irgendeinem anderen Vorgang, der mit Magen zu tun hat, kann man nicht empfehlen, solchen Gesprächen zu lauschen. Die junge, hagere Frau mit der gedrehten Zigarette, beginnt ihre Erzählung aus dem Nichts (es ist halb acht Uhr morgens), dass sie ihr Kind verloren habe. Dritter Monat. In der Badewanne. „Flutsch. Einfach so.“ sagt sie. Aber sie habe ja bereits eine 16-jährige Tochter. Ich renne weg. In der Raucherzone sitzen zwei Frauen mit den kratzigen, tiefen Stimmen und dem Gemüt herzhaft knackiger Baumfäller. Sie unterhalten sich über Ausfluss und innere Blutungen, als ginge es um ein neues Kochrezept. Ich renne weg.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, gut aussehende Menschen würden nicht krank. Sorry, aber es sieht so aus. Oder die Gutaussehenden werden in anderen Häusern gehalten. Oder sie rauchen nicht. Also sieht man sie nicht vor den Eingängen herumlungern. Kann aber auch sein, dass die Schönen eine eigene frische Luft erhalten. Vielleicht oben in einem Penthouse-Garten. Dort haben sie Ausgang und da unten vor der Drehtür stehen die Gefallenen und Elenden, die Männer und Frauen in Krankheitskleidung, in Bademänteln und Sporthosen, in Schlappen oder mit übergeworfenen Mänteln, in Rollstühlen mit ausgestreckten Beinen und nackten Zehen, mit Gehhilfen und dicken Kindern. Oben im Penthouse-Garten knabbern die Schönen mit ihren Zipperlein an Möhren und schnappen ihre frische Luft. Ich weiß es nicht.
Wenn Edelgard Schnipper-Henrichs klimpert
Entlassene warten mit ihren Taschen und Koffern auf ihre Anverwandten oder das Taxi. Das Essen auf Rädern ist bereits organisiert. Ich löffle meinen Frankenland-Joghurt Fit 0,1 % Fett. Ich treffe den Chefingenieur der Abteilung und er teilt mir mit, dass die lang erwartete Untersuchung meiner Beinmuskulatur am Nachmittag stattfände. Ich bin es also – „vielleicht“. Das erfüllt mich mit einer solchen Fröhlichkeit, dass ich beschließe, das Klavierkonzert im Foyer wahrzunehmen. Dort vor dem Eingang zum Bistro steht dieses schwarze Piano, als habe es dort jemand vergessen. Dort sitzt Edelgard Schnipper-Henrichs (zugegeben, der Name ist erfunden, aber es gibt keinen Hinweis auf die Künstlerin). Sie spielt eine Largo-Version von „Something stupid“. Welch ein passender Titel.
Ich bin der einzige Zuhörer auf den Drahtstühlen an der Wand. Aufzüge gehen auf und zu. Liegendkranke werden hin- und hergeschoben. Ein älterer Patient setzt sich dazu. „Something stupid“ – Ich bin drauf und dran, mitzusingen, aber ich beherrsche mich, gehe auf und ab unter den Klängen dieser musikalischen Annäherung an Frank Sinatra. An der Wand neben Aufzug 1 hängt eine Hommage auf Leinwand an Pina Bausch. Eine wunderbare Fügung, dass sie von diesem Bild keine Kenntnis mehr erhalten wird. Man sieht eben in einem Krankenhaus auch grausame Dinge. Und es folgt die musikalische Klimax, die ich erwartet hatte: Richard Clayderman. Der ältere Herr im Zuschauerraum hält seinen Kopf eigenartig schief. Ich muss fliehen. Ich bin kein Arzt. Ich kann jetzt auch nicht helfen. Jemand wird ihn schon finden. Und ein anderer wird eventuell das Piano töten und Frau Schnipper-Henrichs in ein Koma versetzen.

Hommage an Pina Bausch in lila
Im Fahrstuhl bin ich mit der Stationsschwester allein, die mir berichtet, sie käme immer mit guter Laune zur Schicht. „Ich komme lächelnd hier morgens an. Ich bin gut gelaunt.“ Und abends in der Düsternis ihrer Wohnung sei alle Energie von ihr abgesaugt und sie freue sich wieder auf den nächsten Morgen. Ich wünsche ihr ein schönes Leben.
Zurück in der wirklichen Welt
Die Verwaltung ruft mich an und fragt, ob ich einen Abschlussbericht benötige. Ich beharre auf einen Zwischenbericht, denn ich habe noch so einiges vor im Leben. Solche Gags kommen woanders besser an. Ich bereite mich auf meine Entlassung vor. Noch ein weiterer Tag und der Gewöhnungsprozess würde einsetzen. Dem zu entgehen, ist lebenserhaltend, denke ich.
Die neurologische Muskeluntersuchung ist ein Vorgang, der zeigt, was man mit Menschen alles anstellen kann. Eine Nadel wird in den Muskel geschoben, von außen naturgemäß. Der Arzt dreht die Nadel, schiebt sie einmal in die eine, dann in die andere Richtung. Sagen wir mal so: Es ist unangenehm. Ich könne nun mit meinem Muskel musizieren, sagt er. Und in der Tat – ich produziere durch Muskelanspannung den Sound eines Maschinengewehrs, elektronisch etwas verfremdet und somit feure ich Salven ab, die an ein Filmgemetzel erinnern. Bilder aus Vietnam kommen mir in den Sinn. Ich schieße mit meinem Muskel.
Es ist später Nachmittag und ich packe meinen Koffer. Ich kann gehen. Obwohl die Entlassungen morgens stattfinden, ist es mir frei gestellt, bereits des Abends die Lokalität zu verlassen. Ich steuere einen Supermarkt an. Alles scheint mir fremd. Bereits nach viereineinhalb Tagen muss ich erst wieder in die reale Welt eintauchen. Ich trage weder Bademantel noch Blutzufuhrkabel. Ich schleppe meinen Plastikbeutel mit Kartoffeln und fetthaltigen Lebensmitteln in das Auto und fahre heim.
Ende