Griechischer Finanz-Krimi: Weiße Rosen waren gestern
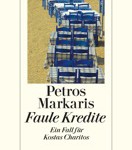
In die Zeit, in der um die Verabschiedung des zweiten Griechenland-Hilfspaketes gerungen wird, Finanzmärkte stündlich die Farbe wechseln, Anleihen keine Option mehr sind, genau in diese Zeit fällt die deutschsprachige Veröffentlichung von Petros Markaris sechstem „Kostas Charitos“-Roman. In „Faule Kredite“ schickt der Autor seinen Kommissar mitten in die Athener Bankenwelt.
Die griechische Finanzwelt steckt in einer der schlimmsten denkbaren Krisen. Die Stimmung in Athen ist aufgeheizt. Täglich wird auf den großen Plätzen demonstriert, Aufrufe zum Bankenboykott werden in der ganzen Stadt plakatiert. Als ob das nicht Bewährungsprobe genug wäre, erschüttert eine Mordserie an Bankern und Finanziers die Stadt. Vier ranghohe Manager, allesamt Symbolfiguren für Korruption und Mißwirtschaft, werden nacheinander mit einem Säbel enthauptet. Charitos glaubt an einen persönlichen Rachefeldzug. Der Tod in Athen kommt heutzutage auf Kredit und bringt keine mythologisch verklärten Märtyrer mehr hervor. Mit dieser Meinung steht der Herr Kommissar zunächst einmal recht alleine da. So darf er sich zu allem Überfluss auch noch mit der Terrorabwehr mehrerer Staaten, diversen Ministerien und Botschaften herumschlagen. Darüberhinaus ist auch sein Privatleben nicht gerade von Spannungen frei. Die Krise hinterlässt auch hier ihre Spuren.
„Nur die ersten 80 Jahre sind hart. Ab dann hast Du für immer Deine Ruhe“ – sagt Charitos‘ lebenskluge Gattin Adriani. Sein Kollege greift zu noch drastischerem Trost “ ….wir zählen doch zu den PIIGS Staaten. Aber im Schweinestall lebt es sich immer noch besser als im Haifischbecken. Bislang haben wir versucht, dort mitzuschwimmen, aber wir sind kläglich abgesoffen. Schweine können eben nicht schwimmen.“ So kann man die aktuelle griechische Tragödie natürlich auch kurzfassen. Mit diesen und ähnlich schicken Wortbildern läßt Markaris seine Protagonisten über die aktuelle Krise diskutieren und an ihr leiden.
Markaris – intellektueller Weltbürger, einer der wichtigsten Autoren zeitgenössischer griechischer Literatur, als Übersetzer von Goethe und Brecht der deutschen Sprache fließend mächtig – ist durch seine Kostas-Charitos-Krimis europaweit bekannt geworden. Wie kein anderer ist er gerade hierzulande als Interviewpartner gefragt, wenn es darum geht, den Deutschen zu erläutern, wie die Griechen ticken. Nur folgerichtig, dass der Diogenes Verlag die deutschsprachige Veröffentlichung dieses allerersten Romans überhaupt zur Krise auf Anfang Juli vorgezogen hat. Die Zeit, die deutsche Fassung höchstpersönlich gemeinsam mit der sorgsamen Übersetzerin Michaela Prinzinger durchzusehen, hat der Autor sich dennoch genommen. Faule Kredite ist erst der Auftakt. Wie Markaris in mehreren Interviews ankündigte, arbeitet er an einer Trilogie der Krise, welche diese als Alltagsphänomen betrachtet wissen will. Da passt es gut, dass bereits in Teil eins das Renteneintrittsalter für hellenische Polizisten um fünf Jahre heraufgesetzt wurde. Nun hat er also noch genug Zeit, der Brunetti Griechenlands, für die Herkules-Aufgabe, die Krise zu beschreiben und zu reflektieren.
Der Roman ist im Präsens geschrieben. Somit ist klar – an eine Reflexion wagt Markaris sich (noch) nicht. Vielmehr serviert er dem Leser eine kriminaltechnisch aufbereitete Bestandsaufnahme neugriechischer Befindlichkeiten. Markaris erzählt unaufgeregt lakonisch, ohne larmoyant zu sein. Mit einem leichten Augenzwinkern blickt er auf sein Land. Der Zeigefinger ist manchmal mahnend, aber immer charmant erhoben. Sein Resümee ist eher humorvoll satirisch als zynisch resigniert. „Ob Krise oder nicht, die Griechen konsumieren gerne im Voraus, leben gerne von Vorschüssen und Vorauszahlungen. Ein Kredit ist nichts als eine übliche Einnahmequelle.“
Die kriminelle Rahmenhandlung jedoch ist ihm eher Mittel zum Zweck. Die eigentliche Handlung ist streckenweise hölzern konstruiert, Ausflüge in die Halbwelten dopingverdächtiger Leistungssportler und illegaler Migranten erzeugen Längen und erschweren die Abrundung des Plots. Der entlarvte Drahtzieher erweist sich zum Schluß als – wer hätte das gedacht – moralisch bewegter Täter. Nur sein Motiv ist arg weit hergeholt. Nicht umsonst schickt er der Erläuterung seines Motivs den Zusatz „Ich will es Ihnen erklären, obwohl Sie mich möglicherweise nicht verstehen werden“ voraus. Gut verständlich aufbereitet hingegen die sorgfältig recherchierten wirtschafts- und finanzpolitischen Hintergründe.
Das letzte Wort im Roman hat Gattin Adriani: „Da kann die Troika sagen, was sie will. In Athen kann kann Dir Vitamin B das Leben retten“. Ja, so ist das wohl. Weiße Rosen waren gestern.
Petros Markaris: „Faule Kredite“. Diogenes Verlag, Zürich. 397 Seiten. € 22,90
