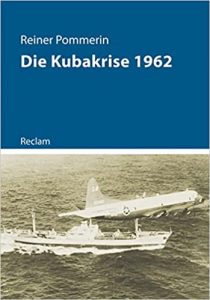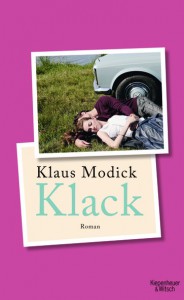Am atomaren Abgrund: Buch über die Kubakrise 1962
Es waren wahrlich dramatische Tage – damals, im Oktober 1962. Wir („My Generation“) waren damals Grundschulkinder und haben kaum etwas von der Kubakrise mitbekommen. Die Medienwelt war noch längst nicht so unabweislich allgegenwärtig.
Man erschrickt noch 60 Jahre im Nachhinein zutiefst, wenn man sich das alles heute vergegenwärtigt; erst recht in Zeiten des europäischen Krieges in der Ukraine. Es ist, als wären wir wieder näher an „1962″ herangerückt.
Schon damals stand die Welt am atomaren Abgrund. Für die Vereinigten Staaten galt als Leitlinie noch nicht die später abgestufte „flexible response“, sondern das Prinzip der „massive retaliation“, also gleich der Griff ins ganze apokalyptische Arsenal.
Bloße Chronistenpflicht?
Rainer Pommerin (Jahrgang 1943), pensionierter Oberst und Geschichtsprofessor, schlägt nicht den großen Bogen einer etwaigen „Neudeutung“ der Kubakrise, sondern erzählt das Geschehen getreulich Punkt für Punkt und Tag für Tag nach, übrigens auch mit jenem Fokus auf Waffentechnik und Militärstrategie, wie er neuerdings wieder in den Vordergrund getreten ist. Der Autor berichtet, als sei’s seine reine Chronistenpflicht, so dass man sich gelegentlich fragt, welchen Standpunkt er eigentlich einnimmt. Pure Objektivität gibt es ja nun mal nicht, sie kann allenfalls ein Wunsch- und Näherungswert sein.
Die Kubakrise wird eingebettet in die Vorgeschichte – von der nahöstlichen Suezkrise sowie den Aufständen in Ungarn und Polen (alles 1956) über den „Sputnik-Schock“ am 4. Oktober 1957 (als die Sowjetunion einen weltraumtechnischen Vorsprung vor den USA erlangte) bis hin zum Berliner Mauerbau am 13. August 1961. Eine hochexplosive Gemengelage zwischen den Machtblöcken hatte sich aufgebaut und angestaut.
Als der Kalte Krieg alles prägte
Mit Fidel Castros kubanischer Revolution hatten die USA den von ihnen überaus gefürchteten Kommunismus seit 1959 sozusagen vor der Haustür. Hardliner argwöhnten, dass die Sowjets es via Kuba auf den gesamten amerikanischen Kontinent abgesehen hatten. Groß war das Entsetzen in Washington, als ein U-2-Aufklärungsflug am 14. Oktober 1962 ergab, dass die Russen insgeheim Abschussbasen und sonstige atomare Logistik auf Kuba installiert hatten – erstmals in Raketen-Reichweite zu US-Millionenstädten.
Bilder von damaligen Treffen der US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower bzw. John F. Kennedy mit dem KPdSU-Chef Nikita Chruschtschow haben nahezu mythischen Status. Derlei persönliche Konfrontationen sind denn doch (in grotesk verzerrter Form) bis in manche Kinderzimmer vorgedrungen. Ich erinnere mich, wie wir Chruschtschows legendäre UNO-Wutrede (die mit seinem angeblich aufs Pult geschlagenen Schuh) mit Stoffbären nachgespielt haben. Kein Zufall, dass damals auch die James Bond-Filme aufkamen. Der Kalte Krieg prägten damals alles. Und jetzt? Das Vergangene ist offenbar nicht völlig vorbei. Es steht freilich unter anderen Vorzeichen.
Die „Falken“ hatten anderes im Sinn
Doch Überlegungen übergreifender Art stellt Reiner Pommerin überhaupt nicht an. Sein Buch liest sich so, als hätte es ebenso gut irgendwann in den letzten 20 oder 30 Jahren geschrieben worden sein können und als sollte es zum 60jährigen Gedenken nur noch einmal den Gang der Dinge rekapitulieren. Dennoch kann man daraus ein paar Erkenntnisse gewinnen – zum Beispiel die, dass beide Weltmächte (China war noch Nebendarsteller auf der globalen Bühne) sich gleichermaßen in die Krise verstrickt haben. Schließlich hatten die USA, bevor die Sowjetunion Atomwaffen nach Kuba brachte, bereits eine ähnliche Präsenz mit Jupiter-Raketen in der Türkei, die 1963 aufgrund einer Geheimvereinbarung zurückgezogen wurden.
Vielleicht hat es beim schließlich doch noch einigermaßen rationalen Umgang mit der Krise 1962 eine Rolle gespielt, dass Chruschtschow und Kennedy aus eigenem Erleben wussten, was Krieg bedeutete und sie sich offenbar vorstellen konnten, wie verheerend sich eine „nukleare Option“ auswirken würde – allen Drohgebärden zum Trotz. Sie reizten das Risiko bis zum Letzten aus, doch fanden sie gerade noch rechtzeitig einen Ausweg. Die „Falken“ beider Seiten hatten ganz anderes im Sinn. Vielleicht ließe sich heute etwas daraus lernen.
Ein verseuchter Neoprenanzug
Das Buch enthält einige geradezu bizarre Fakten, so etwa die US-Pläne, Fidel Castro und „Che“ Guevara aus dem Weg zu räumen. So sollte ein Unterhändler Castro als Geschenk einen Neoprenanzug (mit gefährlichem Hautpilz präpariert) und einen Schnorchel (mit Tuberkel-Bazillen) überreichen. Der Sendbote verweigerte jedoch die Mitnahme der „Gaben“, aus nachvollziehbaren Erwägungen.
Beinahe hätte es sich fatal und final ausgewirkt, dass im Verlauf der Kubakrise einmal unterschiedliche Zeitzonen nicht berücksichtigt wurden. Zudem verzögerte sich der Austausch diplomatischer Noten durch umständliche Ver- und Entschlüsselung. Dabei war auf dem Höhepunkt der Krise doch allergrößte Eile geboten.
Kennedy durfte erst einmal ausschlafen
Kaum zu fassen auch, dass John F. Kennedy für die Mitteilung zum Berliner Mauerbau nur kurz einen Segeltörn unterbrach und dann sogleich wieder losschipperte. Von wegen „Ich bin ein Berliner“… Auch wurde ihm die Entdeckung der russischen Atombasen auf Kuba am 14. Oktober 1962 nicht sofort mitgeteilt. Die Krisengremien ließen ihn vielmehr erst einmal ausschlafen. Ergänzend hierzu erfährt man auch noch einmal, dass Kennedy keineswegs so viril war, wie er sich im siegreichen Wahlkampf gegen Nixon gegeben hatte. Der Mann war chronisch krank und benötigte ständig Schmerzmittel.
Nach dem Ende der Kubakrise wurden 1963 immerhin drei bedeutsame Schritte im Sinne einer besseren Beherrschbarkeit solcher Großkonflikte unternommen: Ab 6. Juli wurden endlich Geheimcodes für den Abschuss von Atomwaffen eingerichtet, die bis dahin bloß durch mechanische Schlösser „gesichert“ waren. Am 20. August wurde eine Fernschreiber-Verbindung zwischen Weißem Haus und Kreml als „heißer Draht“ installiert. Am 10. Oktober 1963 wurde ein Abkommen über das Verbot von Kernwaffenversuchen geschlossen.
Nachspann: Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas erschossen. Am 14. Oktober 1964 wurde Nikita Chruschtschow entmachtet. Die Geschichte ging mit anderen Protagonisten weiter – und wurde auf Dauer nicht friedlicher.
Reiner Pommerin: „Die Kubakrise 1962″. Reclam, 160 Seiten. Paperback mit zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen. 14,95 Euro.