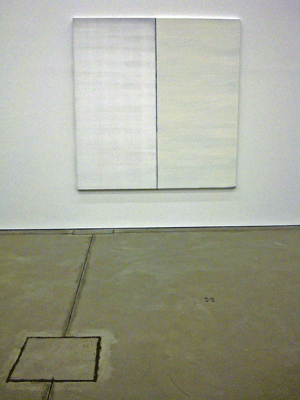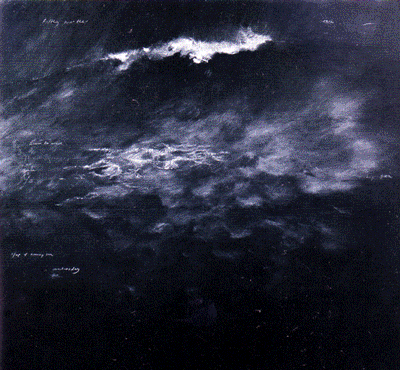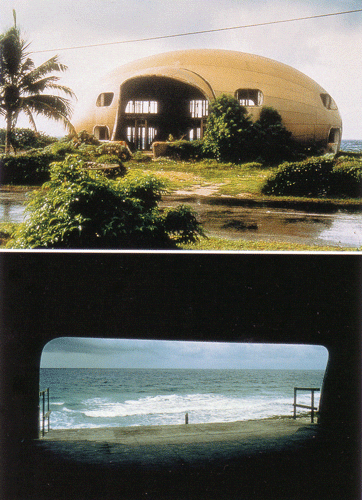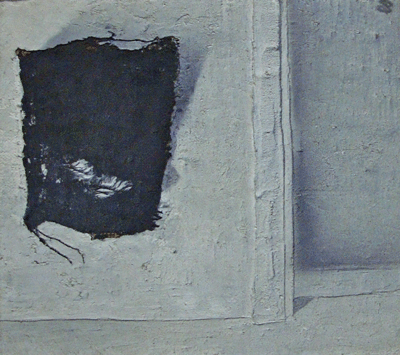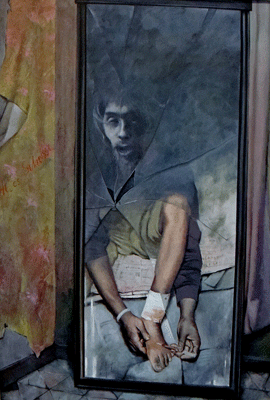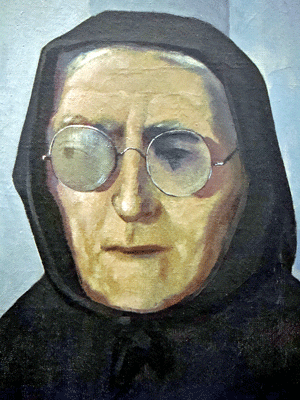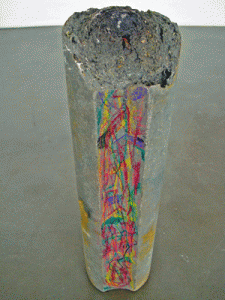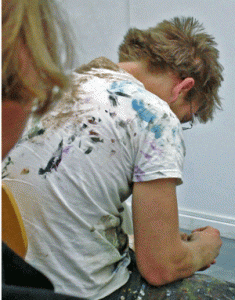Was ist daran politisch? Die dOCUMENTA (13) und die „politische Kunst“
Auf Grundlage dieses großzügigen Politik-Verständnisses lässt sich aller menschlichen Aktivität politische Wirksamkeit bescheinigen, darunter auch ökologischen, psychologischen und sozialen Prozessen. Und diese bilden die Basis zahlreicher Beiträge der dOCUMENTA (13), wodurch sie die bislang interdiszplinärste ist.
Jenseits der twenty-somethings
Einzelne Aspekte der Ausstellung fordern zur Nachahmung auf, wie beispielsweise die Anhebung des Altersdurchschnitts von TeilnehmerInnen und Exponaten.
So lässt sich der Auftritt der 1925 geborenen Etel Adnan und Aase Texmon Rygh, sowie des ein Jahr jüngeren Gustav Metzgers als Aufruf zur Überwindung der im Kunstbetrieb herrschenden Altershierarchie verstehen, derzufolge vor 1970 Geborene für den Markt nur dann interessant sind, wenn sie sich anhaltenden Erfolgs erfreuen.
Synchronizität der Ereignisse: Abgelegene Modernen
Die dOCUMENTA (13) setzt diese Revision von Formen und Inhalten der Moderne fort, indem sie moderne KünstlerInnen jenseits der üblichen Verdächtigen in Erinnerung ruft.
So übertragen Hannah Ryggens Webereien die internationale Politik der 1930er Jahre in ein Amalgam der in Europa verfügbaren Formsprachen.
Emily Carrs und Margaret Prestons Gemälde hingegen verbinden Prinzipien der Klassischen Moderne mit denen der Kulturen der amerikanischen Nordwestküste, bzw. der australischen Aborigines.
Die Vermessung der Kunstwelt
Mit der Öffnung des Zeitfensters erweitert sich auch der geografische Rahmen. Die Integration des Geschehens außerhalb von Europa und den USA ist auf Biennalen, und seit der zehnten auch auf der documenta selbstverständlich. Doch angesichts der noch immer von nationalen Interessen bestimmten Ankaufspolitik der Museen und Sammlungen kommt der Aufmerksamkeit für die Kunstgeschichte abseits traditioneller Zentren Signalcharakter zu.
Grenzwertig
Tarnanstriche
Ohne künstlerische Absicht entstandene Exponate fungieren als ästhetische Lockvögel, die die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen, nicht-ästhetischen Gegenstand lenken.
Infolge einer regimekritischen Äußerung wird Korbinian Aigner zur Zwangsarbeit in Dachau verurteilt, wo er vier neue Apfelsorten züchtet und sie KZ 1 bis 4 nennt. Der Grund für Aigners Anwesenheit auf der documenta sind demnach nicht die mit wissenschaftlicher Präzision gemalten Äpfel als vielmehr die Geschichte vom inhaftierten Dissidenten, der im Wissen um den morgigen Weltuntergang Apfelbäumchen pflanzt und so die tätige Umsetzung des Prinzips Hoffnung verkörpert.
Auch die Anwesenheit von Mark Lombardis minutiösen Geweben verdankt sich nicht ihrer grafischen Attraktivität. Ihr dekoratives Äußeres diente der Offenlegung geheimer Verbindungen zwischen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, deren Nebenprodukt die visuell ansprechenden Diagramme darstellen. Dass die Kuratorin deren ästhetischem Reiz erlegen ist, zeigt die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Personen, Firmen und Institutionen durch elegant geschwungene Linien markiert, die Art dieser Kontakte aber undefiniert ist.
Anders als im Fall von Aigner und Lombardi, wo Formen allein dem Transport von Inhalten dienen, sind bei Goshka Macuga beide Komponenten gleichermaßen ausdrucksstark. Unterhalb der Ruine des Darulaman-Palastes in Kabul haben sich Angehörige des afghanischen und internationalen Kulturbetriebs eingefunden. Die Situation ist von surrealen Versatzstücken unterbrochen, wodurch die Form der Arbeit auf zweierlei Weise irritiert: Optisch ist das vermeintliche Foto eine Foto-Montage, und materiell ein Gewebe. Auch inhaltlich erweist sich die sich dokumentarisch gerierende Aufnahme als inszeniert und mehrdeutig.
Durch die Kombination inhaltlicher und formaler Vielschichtigkeit steht Macuga in der Tradition Hannah Ryggens, die ebenfalls durch ikonografisch eigenwillige und technisch ausgefeilte Webereien Aufmerksamkeit für ihre politischen Botschaften erzielt. Beide Künstlerinnen setzen somit ästhetische Methoden zur komplexen Darstellung politischer Ereignisse ein.
Eine solche ästhetische Aufbereitung nicht-retinaler Inhalte ist nicht zu verwechseln mit Ästhetisierung. Denn statt Inhalte durch gefällige Formen eingängig zu machen, werden abstrakte Phänomene sinnlich erfahrbar und so politisch aussagekräftig.
HIStory
Nach dem Prinzip, wer seine Vergangenheit nicht erinnert, wiederholt sie, werden zahlreiche Beziehungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt.
Eine Chimäre aus Mickey Mouse und Mudschaheddin patrouilliert durch Llyn Foulkes Installation, die als Bühnenbild des posthumanistischen Zeitalters durchgehen könnte: Der Day After all dessen, wovor uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Die Umgebung suggeriert unterschiedliche Lesweisen: Stadt- oder Ruinenlandschaft, unberührtes Geröll oder Trümmerfeld, Vergangenheit oder Zukunft? Durch diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wird die Taliban Mouse zu Walter Benjamins Angelus Novus:
„Die Janusköpfigkeit der Bilder, die verschiedenen Zeiten anzugehören scheinen, setzt sich in Mariam Ghanis Synchronisation der Geschichte Kabuls und Kassels fort, in der das Innere eines einst, neben dem eines noch immer verwüsteten Herrschaftsgebäudes erscheinen. Die Renovierung, die zwischen dem kriegsversehrten und dem heutigen Fridericianum stattfand, steht dem Darulaman-Palast noch bevor. Doch die in den Details zutage tretende Unterschiedlichkeit beider Bauten verweist auf kulturelle Identitäten, die ihre spezifischen Entwicklungen fordern.
HERstory
Die eingangs erwähnte Identität der privaten und kollektiven Sphäre veranlasste KünstlerInnen der 1970er Jahre zur programmatischen Offenbarung des Unterdrückten im Interesse psychischer und physischer Befreiung. Dieser Tradition der Transparenz als Mittel politischer Emanzipation fühlt sich Ida Applebroog spätestens seit 1969 verbunden, als sie 160 Zeichnungen ihrer Vagina anfertigte, die sie später, zu Plakaten vergrößert, als Rauminstallation präsentierte. Verglichen mit dieser wegweisenden Geste nimmt sich die Veröffentlichung einzelner Tagebuchseiten eher schüchtern aus. Ziel jedoch ist nicht eine weitere Grenzüberschreitung als vielmehr die abermalige Integration der privaten in die öffentliche Dimension.
Ein vergleichbares Angebot von Transparenz stellt Lori Waxmans Angebot dar, mitgebrachte Arbeiten der BesucherInnen 25 Minuten lang zu begutachten, um anschließend vor aller Augen eine Kritik von 100 bis 200 Wörtern zu verfassen, und so eine undurchsichtige Prozess unter Einschluss der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen.
Tunix
Zivilisationskritik äußert sich auch in Andrea Büttners Videodokumentation über im Schausteller-Millieu engagierte Ordensfrauen, ergänzt von Holzschnitten, die abstrahierte Zelte darstellen – Behausung der Nichtsesshaften und Flüchtlinge.
Bodenständig
Die Erfindung des Tafelbildes markierte einst den Übergang vom religiös motivierten Handwerk zur Kunst. Die an den Flügelaltar gebundene Malerei wurde mobil und ließ sich verschiedenen Kontexten anpassen. Nun holt Pich die Standortgebundenheit zurück ins Tafelbild. Mit dem für lokale Eigenheiten sensibilisierten Blick des Rückkehrers fertigt er das universale Raster aus einheimischen Rohstoffen Bambus, Erden und Bienenwachs an.
Verglichen mit Pichs Erdung der universell transportablen Währung Bild schlägt Doreen Reid Nakamarra die umgekehrte Richtung ein. Um den Verkauf zu ermöglichen, überträgt sie ihre, nach Tradition der Aborigines auf dem Boden ausgeführten Arbeiten auf Leinwand und speist so die einstige Bodenzeichnung in den globalen Kunsthandel ein.
Die Verwandlung von Erde zu Geld gehört zu den Werken, die das Verhältnis abstrakter und konkreter Werte thematisieren – allen voran die wirtschaftliche Ab- und Aufwertung der Elemente Erde, Wasser, Luft und menschlicher Arbeitskraft.
Ja, aber. Was ist denn nun daran politisch?
Die interdisziplinäre Ausrichtung der dOCUMENTA (13) deutet darauf hin, dass ein Grund für das Scheitern politischer Programme im Outsourcing einzelner Segmente aus dem politischen Aktionsradius liegt. Statt die Anliegen wissenschaftlicher, wirtschaftlicher oder kultureller Bereiche rechtzeitig im politischen Zusammenhang zu thematisieren, werden die Sprengkraft bergenden Felder aus dem politischen Geschehen ausgelagert.
Angesichts dieser Optionen des selbst- und fremdbestimmtem Engagements tendiert die dOCUMENTA (13) zur Funktionalisierung, d.h. zur Anwendung künstlerischer Strategien im Interesse sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Ziele.
Das Plädoyer für die Gleichwertigkeit von Altersgruppen und Kunstgeschichten verschiedener Zeiten und Räume lässt die Hierarchien des Kunstbetriebs anachronistisch scheinen.
Auch die Integration verschiedener Wahrnehmungsformen hat Modellcharakter, da Lösungen für wirtschaftliche und ökologische Probleme eine Erweiterung der auf Menschen zentrierten Sicht erfordern. Solche Lösungen entstehen nicht durch eine bloße Verschiebung von einem Zentrismus zum nächsten, sondern durch ein Auflösen aller auf einzelne Gruppen beschränkten Herrschaftsformen zugunsten horizontaler Verfahren.
All diese Prinzipien – Interdisziplinarität, Einsatz künstlerischer Praktiken zugunsten nicht-künstlerischer Ziele, sowie Dezentralisierung – treten im Rahmen der Ausstellung und der sie begleitenden Veranstaltungen in einer Vielzahl von Varianten in Erscheinung. So werden die vielzitierten Möglichkeitsräume nicht nur angedeutet, sondern auf genuin künstlerische Weise inszeniert.