Appetithäppchen aus der Fremde – Dennis Gastmanns „Atlas der unentdeckten Länder“
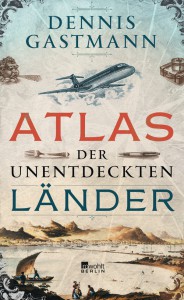 Wenn es einer schwer hat in der durchkarthographierten, digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts, dann ist es der Entdecker und Abenteurer. Die Welt ist vermessen, ganz bequem kann man vom Schreibtischstuhl aus per Mausklick allüberall hinreisen. Was also tun, wenn man im Herzen ein Entdecker und Abenteurer ist?
Wenn es einer schwer hat in der durchkarthographierten, digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts, dann ist es der Entdecker und Abenteurer. Die Welt ist vermessen, ganz bequem kann man vom Schreibtischstuhl aus per Mausklick allüberall hinreisen. Was also tun, wenn man im Herzen ein Entdecker und Abenteurer ist?
Der Journalist Dennis Gastmann ist so einer, getrieben von der Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer, will er so schnell nicht klein beigeben. Natürlich weiß er, „dass alle Länder dieser Welt längst entdeckt worden waren“, er weiß „aber auch, wie unerreichbar manche von ihnen scheinen.“ Also macht er sich auf und sucht „das Unbekannte, verborgene Königreiche, verbotene Berge, ferne, vergessene, magische Orte“ wie die tausendjährige Mönchsrepublik Athos. Er überwindet Berge und Ozeane, aber auch ungezählte „bürokratische Schützengräben“. An all dem lässt er den Leser in seinem „Atlas der unentdeckten Länder“ teilhaben.
Unter Haien und in der Wüste
Eingerahmt von sorgfältigen Schwarz-Weiß Illustrationen, die Details aus den Geschichten zeigen, erzählt Gastmann in seinen Reportagen von versinkenden Inseln wie dem einstigen Zufluchtsort der Bounty-Meuterer Pitcairn und von deren eigenwiligem Autarkie-Verständnis. Er taucht mit Haien, kämpft gegen Sandstürme in der Wüste und wandelt auf den Spuren von Tom Hanks, als er tagelang in einem Flughafenterminal kampiert.
Wenn es nicht anders geht, arrangiert sich Gastmann für seine Reise auch mit Staatsformen, die durchaus als mafiös zu bezeichnen sind (und das ist noch wohlwollend). Immerhin kann er von sich sagen, die Gastfreundschaft der Karakalpakstaner genossen zu haben. Ihm ist kein Weg zu weit, um seine journalistische Neugier und seine Entdeckerfreude zu stillen.
Sehnsucht nach dem Abenteuer
Aber was genau er bei all dem herausfinden will, wird nicht ganz klar. Die einzig klare Intention ist es, Abenteuer zu erleben, alles andere bleibt im Ungefähren.
Dennis Gastmann ist ein deutscher Reise-Schriftsteller und Moderator, eine erste größere Öffentlichkeit erreichte er mit gleichermaßen witzigen wie entlarvenden Beiträgen für das Satiremagazin „Extra3“, in dem Gastmann in die Rolle der renitent penetranten Reporterfigur „Dennis“ schlüpfte. Gastmann bezeichnet sich selbst als Gonzo-Reporter. Diese Form von Journalismus charakterisiert sich durch die Berichterstattung aus subjektiver Sicht des Autors, der sich und seine Erlebnisse selbst in Beziehung zum Thema setzt.
Und genauso subjektiv muss man sich auch an die Lektüre dieses Buches begeben. Dennis Gastmann geht es allenfalls am Rande um die Vermittlung von Wissen, Vorwissen wird sogar vorausgesetzt. Besser man hat bei Lektüre immer ein Nachschlagewerk der Wahl zur Hand. Oder ein kleines, feines Kulturportal mit Bildungsanspruch – dann weiß man zumindest im Kapitel über Ladonien, worüber genau der Autor da gerade so wehmütig sinniert.
Schmaler Erkenntnisgewinn
Gastmann ist unbestritten ein sehr genauer Beobachter. Umso bedauerlicher, dass er von seinem mühevollen Reisen meist nur Mikro-Ausschnitte wiedergibt. Letzten Endes ist sein Buch nicht mehr als eine Sammlung von zwar amüsanten flott geschriebenen Anekdoten, deren Erkenntnisgewinn aber marginal ist und sich auf Urteile wie „Wilhelm Bligh, der cholerische Kapitän der Bounty, war ein überforderter CEO“ beschränkt.
Wer vorherige Werke von Gastmann wie beispielsweise seinen Ausflug in die „Geschlossene Gesellschaft“ der Superreichen kennt, vermisst auch die leichte Prise Boshaftigkeit, die seine Werke sonst oft begleiteten. Das geht einerseits in Ordnung, weil er mit viel Respekt auf die schaut, denen er begegnet. Andererseits fehlt aber der kritische Blick auf soziale und politische Mißstände. Den muss sich der Leser schon selbst aus erwähnten Versatzstücken zusammenklauben.
Meinung wird schmerzlich vermisst
Schon beim Titel empfindet man leichte Irritation – das Werk enthält weder genauere Ortsbeschreibungen noch wenigstens eine Karte, die den Titel Atlas rechtfertigen würde. Und dieses Gefühl der Irritation bleibt. Wenn man sich als Leser auf Reisereportagen einlässt, dann will man doch etwas lernen, etwas Neues erfahren. Anekdoten wie die gebotenen bekommt man auf jeder Familienfeier und da ist es irgendwo auch egal, ob sie vom öffentlichen Nahverkehr am Chiemsee oder in Palästina handeln.
Nun könnte man argumentieren, dass die Berichte über unterschiedlichen Lebensstile immerhin die Frage aufwerfen, was uns das über den Rest unserer durchorganisierten Welt sagt. Auch Gastmann stellt diese Frage, aber er geht ihr auch nicht im Ansatz nach. Da ist er – Gonzo hin oder her – klassicher Journalist. Er berichtet und fertig. Dabei wäre die Meinung desjenigen, der wirklich vor Ort war, schon interessanter gewesen als die Meinung, die man sich als Leser nach den servierten Häppchen selber bildet.
Dennis Gastmann: „Atlas der unentdeckten Länder“. Illustrationen von Harry Jürgens. Rowohlt Berlin. 267 Seiten, €19,95.
