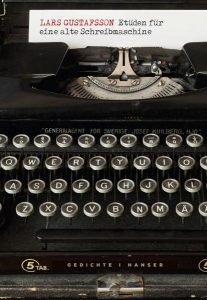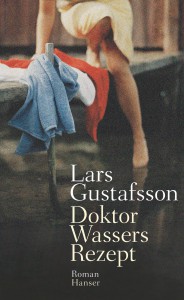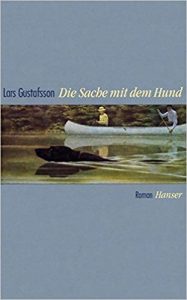Der Mensch ist nur ein flüchtiger Schatten – Lars Gustafssons letzte Gedichte: „Etüden für eine alte Schreibmaschine“
Es ist, als solle einen schon der Titel unserer Zeit entrücken: „Etüden für eine alte Schreibmaschine“ heißt der (erst) jetzt bei uns erschienene Lyrikband von Lars Gustafsson. In Schweden ist das schmale, doch gehaltvolle Buch bereits 2016 herausgekommen, also im Todesjahr Gustafssons, der am 3. April 2016 gestorben ist. Diese Gedichte sind kein großes Vermächtnis, sondern wirken wie ein letzter, elegischer, wissend lächelnder Abschiedsgruß, der eben schon auf andere Sphären verweist.
Das erste Gedicht „Der Mann, der Hund, die Schatten“ lässt vage, schattenhafte Erscheinungen vorüberhuschen. Auch die weiteren Seiten enthalten vielfach Zeilenfolgen, die sich beinahe im Nichts verlieren und entschwinden, vor allem in nächtlichen und winterlichen Landschafts-Kulissen.
Etliche Gedichte sind so federleicht wortsparsam wie Haikus. Bloß nichts Überflüssiges hinsetzen! Unscheinbar, bescheiden, ja nahezu demütig und wie nebenher verfasst kommen einige dieser kleinen Schöpfungen daher. Aber das kann ja nicht stimmen. Der Dichter hat gewiss noch einige Mühen darauf verwendet. Das lyrische Ich sucht dabei nicht zuletzt Orte der Kindheitserinnerungen auf. Wie es gegen das Ende hin so zu sein pflegt.
Auf den Titel des Bandes kommt ziemlich früh das äußerlich fassbarere Gedicht „American Typewriter“ zurück. Es beschwört den länger zurückliegenden Augenblick, in dem am Metropolitan Desk der New York Times eine einsame Remington-Schreibmaschine betätigt wurde, nein: „…in einer Kaskade von Anschlägen aufbrauste“. Sodann heißt es:
„Es war eine Zeit,
als man die Menschen
noch denken hörte.“
Ja, es war noch eine ganz andere Materialität im Spiel, als beim vergleichsweise „lautlosen“ Geklapper auf Computern, bei dem freilich inhaltlich oft genug Getöse herauskommt.
Ansonsten geht es luftiger zu. Da erahnen wir beispielsweise: Verlassene Dinge, vorzugsweise in der schwedischen Provinz, von denen die Farbe abgeblättert ist; den Möglichkeits-Moment, bevor ein Solist im Konzert den ersten Ton spielt; die längst „erledigten“, niemals eingelösten Verheißungen abgelaufener Kalender; die Buchstelle, die ein vergilbtes Lesezeichen von 1929 noch markiert und hinter der vielleicht eine ganze Lebensgeschichte aufscheint…
Mehrfach werden Grenzgelände erwähnt: Grenzen des Erzählens, Grenzen der Galaxis, des Universums gar. Hinaus, hinaus ins Endlose? Im allerletzten Gedicht, dem „Epilog für die Ratlosen“, lesen wir jene Aufforderung, die in eine andere Welt führen könnte:
„Komm, müder Körper!
Komm, müde Seele!“
Und wie vergänglich waren Tun und Trachten im Leben! Gustafsson resümiert sein Metier, seine viele Jahrzehnte währende, wahrlich fruchtbare Autorenschaft im lyrischen Zuschnitt so lakonisch:
„Ich habe mein Leben damit verbracht
die Buchstaben des Alphabets
auf verschiedene Arten zu ordnen.“
Mehr noch: Einem anderen Gedicht zufolge scheint die ganze – ziemlich groteske – Geschichte der Philosophie sozusagen hinter Schneegestöber zu verschwinden. Ist denn alles Geistige nur ein Sortiervorgang oder flüchtige Illusion? Sollte auch jeder Mensch nichts als ein letztlich einsamer Schatten sein, wie es im Gedicht „Solipsismus“ heißt?
Kein Wunder, dass in diesem Band entscheidende Fragen angeschnitten werden, die (eventuell) letzten Dinge betreffend, allerdings mit Drall zur Komik:
„Ich frage mich:
Wenn man also in der Hölle ankommt, woher weiß man, dass man wirklich in der Hölle angekommen ist?
Und nicht nur in einer Ecke des Üblichen?“
Lars Gustafsson: „Etüden für eine alte Schreibmaschine“. Gedichte. Aus dem Schwedischen von Verena Reichel. Carl Hanser Verlag. 80 Seiten, 18 Euro.