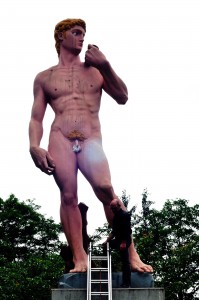Das Mandelring Quartett im Duisburger Lehmbruck Museum. (Foto: Werner Häußner)
Noch schmücken sie die Gehölze, die verblassenden Farben des Herbstes, aber das Rascheln der Schritte durch das Laub verrät, dass es nicht mehr lange so bleibt. Die lichten Kronen der Bäume, die nackten Zweige der Sträucher lassen das Duisburger Lehmbruck Museum schon von weitem durch den Park leuchten.
An mehreren Abenden strahlten die Spots länger als üblich auf die Skulpturen der renommierten Duisburger Sammlung: Es gab Musik im Museum. Das Mandelring Quartett präsentierte alle fünfzehn Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch in fünf Konzerten – zwei davon allerdings im Kulturforum Franziskanerkloster im niederrheinischen Kempen.
Die Duisburger Philharmoniker und Kempen Klassik e.V. ermöglichten damit ein Ereignis, das sonst etwa den Salzburger Festspielen (2011) oder wenigen Kammermusikzentren vorbehalten ist. Erst neun Mal, sagt die Geigerin Nanette Schmidt, habe sie einen solchen Zyklus gespielt, obwohl sich das vor 38 Jahren gegründete Mandelring Quartett seit mehr als 15 Jahren immer wieder diesen epochalen Werken des 20. Jahrhunderts widmet. Die 2011 erschienene CD-Box gilt inzwischen als eine der Referenzaufnahmen und kann den „Klassikern“ etwa des Borodin- oder des Brodsky-Quartetts auf Augenhöhe begegnen.
In diesem Fall ist eine zyklische Aufführung auch kein leistungsprotzender Musik-Marathon, bedient keinen Vollständigkeits-Fetisch und keine Marketing-Strategie. Die Konfrontation der Zuhörer mit den zwischen 1938 und 1974 entstandenen Quartetten zeigt wider erstes Erwarten nicht so sehr Linien einer Entwicklung oder gar eine Steigerung der künstlerischen Ausdrucksmittel – die beherrscht Schostakowitsch schon im ersten Quartett, das er schreibt, als er bereits durch fünf Sinfonien und seine Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ als führender Komponist der Sowjetunion anerkannt war und die lebensgefährliche stalinistische Kulturpolitik in eigener Person erdulden musste.
Die Faszination des Individuellen
Sondern: Hört man alle 15 Quartette in einer solchen Konzentration, ideal verteilt auf vier Tage, erschließt sich, wie individuell jedes einzelne gearbeitet ist, wie profund Schostakowitsch klassische Vorgaben und einander ähnelnde Strukturmuster immer neu variiert, aber durchaus auch, wie er noch in vorgerücktem Alter offen für Neues ist und etwa ab dem 12. Streichquartett von 1968 mit zwölftönigen Themen experimentiert.

Drei Konzerte fanden im Duisburger Lehmbruck Museum (Bild) statt, zwei in Kempen. (Foto: Werner Häußner)
Mit Vergnügen meint man wahrzunehmen, wie er sich etwa im ersten Satz des dritten Quartetts mit leiser Ironie von der gassenhauerischen melodischen und rhythmischen Erfindung distanziert. Schmunzeln lässt sich, wenn er ins Neunte Quartett die berühmte Galoppade aus Rossinis „Wilhelm Tell“ einbaut. Der Musikjournalist Jonas Zerweck wies in seinen kundigen Einführungen immer wieder auf solche aufschlussreiche Details hin. Etwa wie Schostakowitsch im ersten Satz des Zweiten Quartetts schon mit dem Titel „Ouvertüre“, aber auch mit kompositorischer Raffinesse verschleiert, dass er einen an Beethoven angelehnten – und damit in der Sowjet-Musikästhetik verpönten – Sonatenhauptsatz konstruiert hat.
Aber wichtiger als solche Detail-Reminiszenzen ist, wie Schostakowitsch seine eminente satztechnische Kunst verfeinert, expressiv schärft und in den letzten Quartetten gegen Ende seines Lebens reduziert und damit atemberaubend konzentriert. Wie erschütternd das wirkt, war an den Zuschauern abzulesen: Der Schlussgesang des Zyklus, das nur aus langsamen Sätzen bestehende 15. Quartett, nahm dem Auditorium wahrhaftig den Atem. Selten erlebt man eine solche ergriffene Stille.
Mit existenziellem Ernst musiziert
In der Ästhetik ihrer Wirkung passen die Quartette in die Jahreszeit. Selten hört man unbeschwerte Musik, nur eines endet mit einem schlagkräftigen Finaleffekt. Auch das heiter-gelöste Sechste geht ruhig-harmonisch zu Ende. Ob in jenseitigem Pianissimo verschwebende oder in ätherischer Zurücknahme ersterbende Finali: Das Mandelring Quartett musiziert in solchen Momenten mit einem existenziellen Ernst, der jede Kunst„fertigkeit“ hinter sich lässt und sich dem emotionalen Risiko des Augenblicks ungeschützt aussetzt. Genannt sei speziell das Ende des Achten Streichquartetts. Als es verklungen war, fanden sich in der Kempener Paterskirche erst nach langem, regungslosem Verharren die ersten Hände zu zögerndem Beifall zusammen.
Dass die drei Geschwister Nanette, Bernhard und Sebastian Schmidt gemeinsam mit dem Bratscher Andreas Willwohl nicht auf solche herausgehobenen Momente spekulieren, versteht sich. Aber die konstante Achtsamkeit, das gleichbleibend überragende spieltechnische Niveau aller fünf Konzerte ist alleine schon als mentale Leistung wert, herausgehoben zu werden. Am Beginn des ersten Quartetts dauert es nur wenige Augenblicke, bis sich die Vier zu gelassenem Miteinander gefunden haben. Von Auftritt zu Auftritt wächst die Konzentration, so als verlören die Musiker keine Energie aus der Anspannung der vorherigen, sondern zögen daraus die Kraft für das nächste Konzert.
Hervorzuheben ist, wie präzis sie selbst im dichtesten Geschlinge der Linien, im härtesten rhythmischen Ostinato, im zerbrechlichen Pianissimo übereinstimmen. Stets herrscht transparente Balance, stets bleibt durchhörbar, wie komplex Schostakowitsch mit dem motivischen Material umgeht. Es gibt keine klangliche Überwältigungsstrategie; alles wächst aus dem Notentext heraus.
Alle Vier sind gleichermaßen gefordert
Schostakowitsch fordert alle Vier gleichermaßen, gibt jedem Instrument ausgedehnte solistische Auftritte, sucht alle möglichen Kombinationen auszureizen. Zunächst wirken das dialogische einander Zuspielen von Motiven, das Kehraus-Temperament des Finalallegro des Ersten Quartetts, auch die harmonischen Verschränkungen des Kopfsatzes des Zweiten noch in der Tradition verankert. Die schweifend-epische Melancholie langsamer Sätze, noch verstärkt durch den dunklen Gesang der Viola, erinnert an Tschaikowsky oder an die russischen melodischen Formulierungen eines Mussorgsky. Das zelebrieren die Mandelrings mit schönster Hingabe, aber stets auch einer objektivierenden Distanz, die Sentiment außen vor lässt.
Aber im Tanz des Zweiten Streichquartetts wird es ernster: Ein wehmütiger Abglanz vom Walzer-Schwung verschärft sich grimmig. Die Repetitionen des Cello insistieren, treten gespenstische Kaskaden los, bis die Viola mit herbem Ton die stilisierte Folklore des abschließenden Variationensatzes singt. Im Vierten Quartett streichelt Bernhard Schmidt aus seinem Cello seidig-samtige Töne für die jüdischen Melodien heraus, mit denen Schostakowitsch dem weit verbreiteten Antisemitismus Paroli bot – öffentlich allerdings erst nach Stalins Tod, als das Werk endlich vor Publikum uraufgeführt werden konnte. Mal fein und leise ausgekostet, mal energisch durchgezogen werden kontrastierende Themen ineinander geflochten. Da herrscht, auch wenn’s laut werden muss, keine Extroversion, sondern eine behutsam abgestimmte Innerlichkeit.
Mit solchem spieltechnischem Rüstzeug gelingt es dem Mandelring Quartett, die eigene Prägung jedes der Werke auszuschöpfen. Im dritten Satz des Sechsten Streichquartetts zum Beispiel gelingen fabelhafte Wechsel der Klangfarben, von dunkel-samtig zu grell-brillant. Im Achten fasziniert der gedankenverlorene Gesang der ersten Violine Sebastian Schmidts, bevor im zweiten Satz mit vehementen Schlägen ein Inferno losbricht, in dem man sich schwer tut, nicht das Tackern eines Maschinengewehrs zu hören, während heftige Akkorde wie Einschläge dröhnen. Das Quartett trägt die Überschrift „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ – und der Gedanke liegt nahe, dass Schostakowitsch beim Komponieren im Angesicht des noch zerstörten Dresden hier noch einmal die Schrecken des Krieges vergegenwärtigt.
Musik jenseits aller Verstörung
Im Kopfsatz des Fünften brillieren die Vier in einem wunderbar ausgewogenem, aufeinander bezogenem Spiel; Nanette Schmidt mit der zweiten Violine adelt eines der Duette mit der leuchtend intonierenden Bratsche von Andreas Willwohl, der sich immer wieder als ein Meister der Vielfalt auf seinem Instrument erweist. In den melancholischen Gesängen, die Schostakowitsch dem Instrument anvertraut, beschwört er die tröstende Kraft der Musik, die jenseits aller Verstörungen dieser Welt liegt und von ihnen nicht berührbar ist.
Die letzten Abende mit den Quartetten zehn bis fünfzehn versetzen in beinah meditative Betroffenheit. Sicher lässt sich bewundern, wie kontrolliert das Mandelring Quartett die heftigen Kontraste, die gellend insistierende Härte, die Ansätze zum Geräuschhaften in der Musik spielt. Oder wie souverän die unerbittliche Unruhe des Finalsatzes des Zehnten realisiert wird. Oder wie nobel verhalten Sebastian Schmidt mit seinem Vibrato den seidigen, substanzreichen, aber nie üppigen Ton der Violine gestaltet.
Aber die konzentrierte Ruhe, die verklärte Resignation, der erhabene, fast liturgische Duktus spröde konzentrierter Melodien oder die höchste Sensibilität in Ton, Dynamik und Balance reichen nicht aus, die emotionale Tiefe dieser Abschiedswerke zu erklären. Hier geschieht etwas, was der Komponist Moritz Eggert jüngst als essenziellen Teil von Kunst beschrieben hat: Hier geben sich Rätsel auf, stellen sich Fragen, bleiben Erschütterung und Verunsicherung. Wer mit solchen Gedanken in die kalte Herbstnacht hinausgewandert ist, hat aus den Konzerten das mitgenommen, worum es geht.