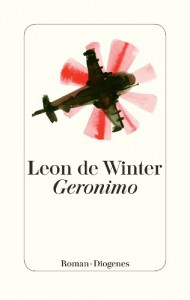Phantasien des Gehirnchirurgen – Leon de Winters Roman „Stadt der Hunde“
Seit einigen Jahren ist es still geworden um Leon de Winter, der einst mit „Hoffmanns Hunger“, „Sokolows Universum“, „Serenade“ und „Zionoco“ die Bestseller-Liste stürmte. Nach einer fast zehnjährigen Pause kommt ein neuer Roman des inzwischen 70jährigen Autors in die Buchläden: „Stadt der Hunde“.
Früher hat de Winter, dessen Familie fast vollständig im Holocaust umkam, einen an Woody Allen erinnernden leichten, witzigen Ton gepflegt, wenn er von den Alpträumen der Überlebenden sprach und sich über antisemitische Dummheiten lustig machte. Seit dem 7. Oktober 2023 ist er schockiert vom offenen Antisemitismus. „Ich glaube“, meint er in einem Interview, „dass das jüdische Leben in Europa bis 2050 der Vergangenheit angehören wird.“
Verschollen auf der Suche nach jüdischen Wurzeln
Jaap Hollander, die Hauptfigur des neuen Romans, ist ein Genie der Gehirnchirurgie. Als Sohn armer jüdischer Eltern aus Amsterdam hat er ich empor gearbeitet zum Star am Mediziner-Himmel. Mit den jüdischen Traditionen kann er nichts anfangen. Als seine Tochter Lea mit 17 nach Israel reist, um sich ihrer jüdischen Wurzeln zu vergewissern, findet er das befremdlich. Die Reise seiner Tochter wird für Jaap zu einem schweren Schicksalsschlag. Denn Lea kehrt von einem Ausflug in die Wüste Negev nicht zurück und bleibt spurlos verschwunden. Das ist zehn Jahr her. Seitdem reist Jaap immer wieder nach Israel, um nach seiner Tochter zu suchen. Dass er dabei sich selbst und sein verdrängtes Judentum neu entdeckt, liegt auf der Hand.
Wenn der Frieden von einer Operation abhängt
Den israelischen Ministerpräsidenten hält Jaap für einen Demagogen und Populisten. Umso überraschter ist er, als ihn der Ministerpräsident bittet, eine riskante Operation durchzuführen, deren Erfolgsaussichten verschwindend gering sind, die aber das Leben einer Patientin retten und der Welt den Frieden bringen könnte. Es geht um die Tochter des saudischen Prinzen, der nicht davor zurückschreckt, seine politischen Feinde umzubringen. Noora, die Tochter des Prinzen, ist vom saudischen Königshaus auserkoren, als erste Frau den Thron zu besteigen, die Gesellschaft zu reformieren und für die Gleichheit von Mann und Frau zu sorgen. Vom Sohn armer Juden aus Amsterdam hängt es also ab, ob das Mädchen überleben und die politische Utopie umgesetzt werden kann. Das klingt kurios, ist aber von Leon de Winter so plausibel ausphantasiert, dass man fast glauben möchte, der Friede in Nahost und der demokratische Wandel in der arabischen Welt könnten mit einem scharfen Seziermesser aus dem Unfrieden der Welt und den verwirrten Köpfen der Menschen regelrecht herausgeschnitten werden.
Alles läuft auf den Alptraum vom 7. Oktober 2023 zu
Als Jaap an der Stelle in der Wüste, an der man Leas Rucksack fand, Gedenksteine niederlegt, nähert sich ihm ein Hund, der ihm auf Schritt und Tritt folgt, mit ihm redet und sagt, er könne ihn zu Lea ins Reich der Toten bringen: Spökenkiekerei, Wahnvorstellung von Jaap, der nach einem Unfall nicht mehr aus seiner Operations-Narkose erwachen mag und seinen Traum mit der Realität verwechselt.
Der wahre Alptraum kommt aber erst noch. Denn der betörend vielschichtig erzählte und verstörend eigenwillige Roman läuft auf ein Datum zu, das in unser Gedächtnis eingebrannt ist: 7. Oktober 2023.
Leon de Winter: „Stadt der Hunde“. Roman. Aus dem Niederländischen von Stefanie Schäfer. Diogenes Verlag, Zürich. 268 Seiten, 26 Euro.