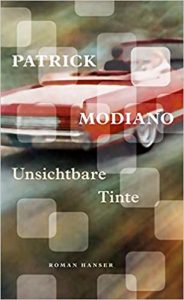„Schönes“ vor 20 Jahren – Erinnerung an eine Bochumer Erstaufführung des jetzigen Nobelpreisträgers Jon Fosse
Der Norweger Jon Fosse erhält den Literaturnobelpreis 2023. Wenn man schon ein paar Jährchen schreibt, findet sich irgend etwas Einschlägiges im Archiv, so z. B. diese – nun nahezu 20 Jahre alte – Bochumer Theaterbesprechung vom 3. Dezember 2003:
Bochum. Verglichen mit den Bühnen-Gestalten des Norwegers Jon Fosse, wirken selbst die gelangweilten Figuren eines Anton Tschechow wie Action-Helden. Hier geschieht nahezu nichts, die Dialoge sind extrem karg. So auch in Fosses neuem Stück „Schönes“. Abermals klingt jede Zwiesprache derart lakonisch, als sei’s bereits eingeübte Tiefsinns-„Masche“.
Doch es ist eine geradezu schwatzsüchtige Lakonie, die redundant in sich kreist und unversehens schräge Komik (irgendwo zwischen Loriot und Kaurismäki) freisetzt. Die Figuren haben Angst vor dem Verstummen, vor der großen Leere.
Fosse (Jahrgang 1959), in den letzten Jahren wohl meistgespielter Dramatiker des Kontinents, lässt weite Deutungs-Spielräume klaffen. Bei der deutschen Erstaufführung in Bochum nutzt Regisseur Dieter Giesing diese schmerzliche Freiheit beharrlich und behutsam.
Das Bühnenbild (Karl-Ernst Herrmann) atmet raumgreifend Ewigkeit: Einander kreuzende (Boots)-Stege verlieren sich nach hinten in die melancholische Unendlichkeit eines einsamen Fjords, vorn ragt eine Planke bis zum Publikum. Die schwarze Silhouette eines Bootshauses wandert geisterhaft langsam über die schimmernde Szenerie. Die Zeit schleicht dahin und verrinnt. Worte kommen aus dem Nichts und versickern im Nichts.
Vor dem Horizont des Stillstands
Vor diesem Horizont des Stillstands verbringt ein Ehepaar mit fast erwachsener Tochter die Sommerferien. Die Frau (Catrin Striebeck) fühlt sich angeödet. Mal geht sie links den Strand entlang, mal rechts. Ein Buch lesen? Ach was! Antriebe und Interessen sind erloschen. Es schwillt in ihr lediglich eine zickige, ziellose Gier an, die sich eher zufällig auf Leif (Ernst Stötzner) richtet, den grandios maulfaulen Freund ihres Mannes aus Kindertagen. Dieser allzeit im Dorf gebliebene Sonderling („Hat sich so ergeben“) lässt sich wohl nur aus höflichem Mitleid auf eine Begegnung im alten Bootshaus ein.
Was dort wirklich geschieht, bleibt freilich ebenso ungewiss wie alles andere: Ahnt der Ehetrottel Geir (Burghart Klaußner) etwas? Warum erschöpft sich dann sein Aufbegehren darin, dass er seine Gitarre immerzu mit hackenden Griffen (verdruckster Frust-Gipfel: „Bang, Bang – I’ll shoot you down“) traktiert?
Anders als bei Ibsen wird hier nichts enthüllt
Warum hat Leif in der Pubertät alle Neugier auf die Welt verloren, warum haben er und Geir damals ihre Rockband aufgelöst? Wird die einstweilen halbwegs vitale, mitunter patzige Tochter (Julie Bräuning), die im Dorf einen farblos strotzenden jungen Mann (Manuel Bürgin) kennen gelernt hat, so heil- und haltlos enden wie ihre Mutter? Und warum preisen sie alle so kleinlaut die Natur? Ist sie ein unnennbar „Schönes“, vor dem der Mensch nur versagen kann? Ganz anders als bei Ibsen, mit dem man Fosse häufig vergleicht, wird hier nichts enthüllt. Die Eltern reisen vorzeitig ab – zurück von der ländlichen in die städtische Seelen-Ödnis. Das ist alles.
Das wattierte Unglück in Hier und Jetzt
Irgend etwas ist vorgefallen und schief gelaufen, doch nun ist es, wie es ist. Existenziell und gnadenlos scharf umrissen stehen die Gestalten in reinster Gegenwart da, im allerdings gedämpften, wattierten Unglück des Hier und Jetzt. Und nun? Was soll noch werden? Dieses folgenlose Weh ergreift einen mehr, als wenn (wie in Gegenwartsdramen oft üblich) aller Schmutz und Ekel im Blut- und Spermastrom verrührt wird.
Dieter Giesings Inszenierung lässt beklemmende Atmosphäre ganz unaufdringlich quellen. Die Darsteller gewinnen diesem stockenden Text staunenswert viele Akzente, Rhythmen und Nuancen ab. Äußerst gespannt folgt man ihrer Expedition in die Leere.