Als Robert Walser von Christian Morgenstern gerügt wurde – eine digitale Dortmunder Fachtagung zum Thema „Korrigieren“
Dortmund. Das haben wir nicht alle Tage: dass von Dortmund aus eine literatur- und medienwissenschaftliche Diskussion angeregt wird und es dazu eine hochkarätige Tagung gibt – in diesen Zeiten freilich digital und virtuell. Wir reden von einer zweitägigen Fachdebatte zum bisher weithin unterschätzten Thema des Korrigierens in vielen Schattierungen. Das Spektrum reicht von der Lektorierung literarischer Texte bis hin zur oft so vermaledeiten Autokorrektur-Software – und ragt in einige andere Bereiche hinein.
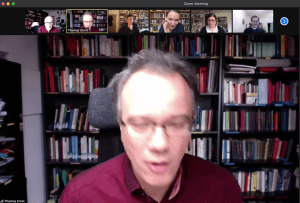
Etwas unscharfer Screenshot von der Videokonferenz-Tagung: Prof. Thomas Ernst beim einleitenden Kurzvortrag, in der Bildleiste darüber weitere Tagungs-Teilnehmer(innen).
Wie noch nahezu jedes Thema, so lässt sich auch dieses im Prinzip unendlich auffächern und in allerlei Feinheiten zergliedern. Was abermals zu beweisen war und sich heute schon zu Beginn der Tagung angedeutet hat. Im Folgenden „schenken“ wir uns sämtliche Professoren- und Doktortitel, praktisch alle Beteiligten tragen den einen oder anderen. Und übrigens: Fast alle zeigten sich den Webcams vor üppig gefüllten Bücherregalen.
Eingeladen hatte das von Iuditha Balint geleitete Fritz-Hüser-Institut (FHI) für Literatur und Kultur der Arbeitswelt, das in der Nachbarschaft des Dortmunder LWL-Industriemuseums Zeche Zollern residiert. Mitorganisator ist Thomas Ernst (Amsterdam/Antwerpen), weitere Wissenschaftler*innen werden aus Bern, Hamburg, Berlin, Saarbrücken, Mannheim, Leipzig, Essen und Bochum zugeschaltet, die Kommunikation erfolgt via Zoom-Konferenz.
Machtverhältnisse und aufklärerisches Potenzial
Iuditha Balint legte in ihrer kurzen Einleitung dar, dass Korrekturen u. a. auch Ausdruck von Machtverhältnissen sein können (wer darf wen wie weitgehend „verbessern“?) und sozusagen ein Gegenstück zum Konzept von genialer oder auktorialer Autorschaft darstellen. Thomas Ernst führte aus, dass das Korrigieren zudem – schon in der Schule, wenn etwa Klassenarbeiten durchgesehen und bewertet werden – normative Funktionen erfülle. Auch Zensoren übten quasi eine Art „Korrektur“ aus. Am anderen Ende der Skala befördere das Korrigieren allerdings auch Formen kollektiver Zusammenarbeit und könne als Instrument der Aufklärung gelten. Wie wissenschaftliche Erkenntnisse sich überhaupt im Dialog und durch ständige Revisionen (also: Korrekturen) konstituieren, habe sich jüngst auch bei der Diskussion virologischer Themen vielfach erwiesen. Da war er, der aktuelle und buchstäblich virulente Bezug. Hier aber gilt’s den Geisteswissenschaften.
Die „Affenliebe“ zum eigenen Schreiben
Den ebenso anspruchsvollen wie interessanten Eröffnungsvortrag hielt sodann Ines Barner aus Essen. Sie skizzierte eine übergreifende Systematik zum Thema der Tagung und verwies dabei auf zwei konkrete Beispiele aus den Gefilden der literarischen Hochprominenz. So hat kein Geringerer als der Lyriker Christian Morgenstern – einer der frühen Lektoren im deutschsprachigen Literaturbetrieb – zeitweise die Betreuung des Romanautors Robert Walser („Geschwister Tanner“) übernommen. Anfangs höchst angetan vom kurz zuvor neu entdeckten Walser, schrieb Morgenstern ihm vor der Drucklegung einen ziemlich harschen Brief. Walsers „Affenliebe“ zum eigenen Text müsse nun endlich aufhören, er schreibe viel zu „weitschweifig“ und „selbstgefällig“, ja nahezu trivial. Sprach’s und strich kurzerhand ganze oder halbe Seiten aus dem ursprünglichen Text… Just solche „Störstellen“ (Ines Barner) hat Robert Walser hernach aufgegriffen, um sie eigenständig umzuarbeiten.
Peter Handke zwischen den Extremen
Anders gelagert war der Fall bei Peter Handke, dem Elisabeth Borchers als Lektorin des Buchs „Langsame Heimkehr“ zur Seite gestanden hat. Handke wusste nicht recht, wie er das Buch enden lassen sollte und steigerte sich in eine regelrechte Schreibkrise hinein, in deren Verlauf er Elisabeth Borchers freie Hand gab, den Text nach Belieben zu ergänzen, was einer Mitautorschaft gleichkam. Ein durchaus ungewöhnliches Verfahren. Handke hat seine Großzügigkeit denn auch später bereut, sich von Borchers als Lektorin getrennt und fortan umso entschiedener auf Unantastbarkeit seines Schreibens bestanden. Von einem Extrem ins andere…
Schon diese beiden Beispiele des Umgangs mit Korrekturen auf dem Felde der Hochliteratur lassen ahnen, wie spannend und vielfältig die Stoffe der Dortmunder Tagung sind. Es werden noch etliche weitere Aspekte in Betracht kommen, beispielsweise: Korrekturen und Lehrerurteile anhand deutscher Abituraufsätze in den 1950er Jahren (Sabine Reh), Korrekturprozesse bei der Verfertigung von Friedrich Nietzsches „Die fröhliche Wissenschaft“ (Stavros Patoussis / Mike Rottmann), „Zur Figur des Korrigierens bei Thomas Bernhard“ (Justus Fetscher), „Korrigieren mit der Schere“ (Marie Millutat) oder auch „Sprachliche Normen und Korrekturimpulse in automatisierten Korrekturprozessen“ (Ilka Lemke / Katrin Ortmann).
Schade nur, dass die Teilnehmerzahl auf rund 100 Leute begrenzt ist. So bleibt die Wissenschaft erst einmal unter sich. Doch Verlauf und Resultate der Tagung sollen später noch publiziert werden; zunächst in einigen Wochen als Zusammenschnitt (auf der Instituts-Seite fhi.dortmund.de), im nächsten Jahr dann als Tagungsband.
______________
P. S.: Auch dieser Beitrag wurde noch einer Korrektur unterzogen. Nur gut, dass er nicht gedruckt vorlag.