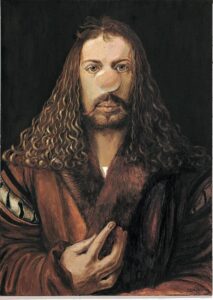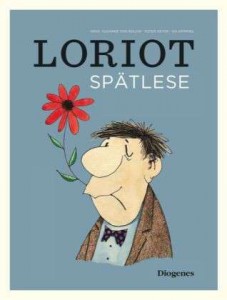Humor mit Fleiß und Akribie: Loriot-Werkschau in Oberhausen
In der etwas älteren Generation, so ungefähr ab 45 oder 50 Jahren, können eigentlich alle Leute aus Sketchen von Loriot herauf und herunter zitieren. Es reichen schon kleine Anspielungen auf Jodeldiplom oder Kosakenzipfel, auf die hochnotpeinliche Nudel im Gesicht, zwei Herren in derselben Badewanne („Die Ente bleibt draußen!“) oder ein schief hängendes Bild als Chaos-Auslöser – und schon ist man mittendrin im Schwelgen und Schmunzeln. Da könnte man glatt von einer „Generation Loriot“ sprechen.
Unter dem lakonischen Titel „Ach was“ (auch so ein unvergänglicher Loriot-Ausspruch) zeigt die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen eine umfassende Werkschau dieses Großmeisters des feinsinnig distinguierten Humors, der 1923 als Vicco von Bülow in Brandenburg an der Havel geboren wurde und 2011 in Ammerland (Starnberger See/Bayern) gestorben ist. Der Pirol (französisch: Loriot) war übrigens das Wappentier der altehrwürdigen Familie. Womit das auch geklärt wäre.

Groteske Liebeserklärung: legendäre Nudel-Szene mit Loriot und Evelyn Hamann. (© Radio Bremen – Do Leibgirries)
Frühe Bilder im Stile Albrecht Dürers
Ganz anders als bei vielen Künstlern, die von den Eltern zu einträglichen „Brotberufen“ gedrängt wurden, hat Loriots Vater den anfangs noch zaudernden Sohn vom Kunststudium überzeugt. In Hamburg lernte Loriot die Kunst auf geradezu altmeisterliche Art. Es sind aus jenen Jahren gar Bilder im Stile eines Albrecht Dürer erhalten. Im Spätwerk hat Loriot wiederum „Große Deutsche“ wie Goethe, Richard Wagner, Nietzsche oder Thomas Mann durchaus liebevoll mit seinem mittlerweile längst etablierten Markenzeichnen, der Knollennase, versehen und ansonsten klassisch porträtiert. So ikonisch waren solche Nasen, dass sie bereits Merchandising-Figürchen inspiriert haben. Loriot hatte eben auch ein Gespür für geldwerte Trends.
Die Exponate stammen zu wesentlichen Teilen aus einer Schau des Frankfurter Caricatura Museums, die für Oberhausen nochmals erweitert wurde, u. a. um eine interessante Dokumentation zu Loriots erster Ausstellung in der DDR (anno 1985, just in Brandenburg), auf die SED und Stasi erst im Nachhinein grollend aufmerksam wurden.
Werbegraphiker und Opern-Liebhaber
Vor allem mit rund 350 Original-Zeichnungen sowie Szenenbildern aus Film und Fernsehen ergibt sich eine frappierende Vielfalt, die auch Kennern von Loriots Schaffen noch etliche Neuigkeiten bieten dürfte. Nicht alle wissen beispielsweise, dass Loriot in seiner Frühzeit oft als Werbegraphiker tätig war (z. B. mit pfiffiger Reklame für Fiat-Automobile, Zigaretten oder strapazierfähige Bodenbeläge). Außerdem hat der leidenschaftliche Musikliebhaber zuweilen Opern inszeniert und dafür auch Bühnenbilder und Kostüme entworfen. Zwei seiner Szenenmodelle sind in Oberhausen zu bestaunen. Ja, sogar das nahezu niedliche Originalmodell jenes Atomkraftwerks, das bei „Familie Hoppenstedt“ in einem legendären Weihnachts-Sketch unterm Tannenbaum explodierte, ist hier zu sehen.
Doch keine „Wirtschaftswunder-Mutti“
Bemerkenswert auch die Geschichte zu Loriots langjähriger Sketchpartnerin Evelyn Hamann. Eigentlich hatte Loriot eine dralle Wirtschaftswunder-Mutti gesucht, doch dann überzeugte ihn die so ganz anders auftretende Hamann mit ihrer kongenialen Schauspielkunst. Weiterer Wissenszuwachs: Loriots berühmtes altes Sofa (in Oberhausen als halbwegs ähnliches Exemplar vorhanden) war zunächst knallrot, weil man das Potenzial des damals gerade eingeführten Farb-Fernsehens ausreizen wollte. Als derlei Effekte nicht mehr so gefragt waren, nahm man ein vergleichsweise dezentes Sitzmöbel in Grün.

Loriots Touristen-Verulkung, die beinahe schon auf Smartphone-Gepflogenheiten vorauszudeuten scheint. (@ Studio Loriot)
Beim Rundgang durch die Ludwiggalerie finden sich viele herrliche Beispiele für Loriots Sprachkunst der erzkomisch misslingenden Kommunikation, die seiner bildnerischen Hochbegabung kaum nachsteht. Überhaupt hat Loriot – auf der Basis ausgefeilter handwerklicher Fähigkeiten – die Arbeit am Humor mit geradezu „preußischer“ Akribie und unermüdlichem Fleiß betrieben. Das Leichte, das bekanntlich schwer zu machen ist… Wie es heißt, ruhte Loriot auch an Wochenenden und zu Ferienzeiten nicht. Zudem soll er an Schlaflosigkeit gelitten und zahlreiche Nachtstunden mit Texten und Zeichnen zugebracht haben. Womöglich sind dabei auch so langlebige Serien wie die über 17 Jahre im „Stern“ allwöchentlich fortgesetzten Bildergeschichten über „Reinhold das Nashorn“ entstanden.
Mit feinem Florett gefochten
Trefflich lässt sich darüber debattieren, ob Loriots Komik recht eigentlich „harmlos“ sei. Sie ist tatsächlich niemals gemein und verletzend, sehr wohl aber hintersinnig und tiefgründig zielsicher. Sie zündet nicht sofort und direkt, dafür aber umso nachdrücklicher. Er focht filigran mit dem Florett, nicht mit dem Degen.
Während Loriots Lebenswerk aus dem Frankfurter Caricatura Museum nach Oberhausen kommt, gastiert die vorherige Oberhausener Schau über Walter Moers in der Mainmetropole. Fürwahr ein hochkarätiger Austausch. Apropos: Die „Neue Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors (Robert Gernhardt, F. K. Waechter, F. W. Bernstein usw.) zählte zu den Bewunderern Loriots. Dass dies wohl für eine Mehrheit der Cartoon-Zunft gilt, belegt eine kleine Abteilung mit Hommage-Arbeiten jüngerer Adepten, sprich: Die „Generation Loriot“ hat ihre Erben.
Loriot – Künstler, Kritiker und Karikaturist. Noch bis 18. Mai 2025.
Neu: verlängert bis 15. Juni! Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr. Eintritt 12 Euro,ermäßigt 6 Euro. Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre Eintritt frei. Kein Katalog, aber zwei begleitende Booklets mit je 16 Seiten zu je 5 Euro. Infos/Buchungen (Führungen) Tel. 0208 / 41 249 28. www.ludwiggalerie.de
_________________________________________-
Der Text ist in ähnlicher Form erstmals im Kulturmagazin Westfalenspiegel (Münster) erschienen: www.westfalenspiegel.de