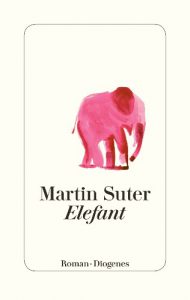Eine Bühne für fiebrige Phantasien – Märchenbilder von Philipp Fröhlich in Wuppertal

Philipp Fröhlich: „Der Rattenfänger von Hameln – die Kinder I“, 2018. Öl auf Leinwand, 275×195 cm (© Philipp Fröhlich)
Schauen wir doch mal, was Philipp Fröhlich nach eigenem Bekunden nicht ist. Er ist kein Fotograf, obwohl er für seine Kunst das Mittel der Fotografie einsetzt, aber nur als vorbereitendes Hilfsmittel zu Dokumentations-Zwecken. Fröhlich ist auch kein Theatermaler, der bildhafte Kulissen für Inszenierungen herstellt. Allerdings ist er studierter Bühnenbildner mit höheren Weihen der Kunstakademie Düsseldorf (Meisterschüler von Karl Kneidl). Zudem bekennt er, fürs Kino gar keinen rechten Sinn zu haben. Dabei wirken seine Gemälde zuweilen, als seien sie in nostalgischem Technicolor ausgeführt. Das alles sind keine Widersprüche, sondern lediglich Klarstellungen, Differenzierungen.
Der 1975 in Schweinfurt geborene Philipp Fröhlich hat 1995 sein Abitur in Wuppertal gemacht, wo er nun in der Kunsthalle Barmen ausstellt. Ein „Heimspiel“ also? Nur sehr bedingt: Von 2002 bis 2016 hat er in Madrid gelebt, dann zog es ihn nach Brüssel.

Märchenthema ausgeschritten: Künstler Philipp Fröhlich. (Foto: Esther Fernández Garcia / © Philipp Fröhlich)
Fröhlich zeigt seine Variationen auf ein populäres, immer noch weithin im kollektiven (Unter)-Bewusstsein verwurzeltes Thema: Märchen.
Besonderheit seiner Vorgehensweise, erklärlich durch seine Bühnenbildner-Spezialisierung: Bevor er die Märchen-Momente malt, baut er das jeweilige Figureninventar und die Szenerien als spielerisch leicht veränderliche 3D-Modelle, die er vielfach fotografiert. Die Dreidimensionalität überträgt sich ersichtlich auf die Leinwände. Fröhlich hat die Situationen gleichsam schon vor dem ersten Pinselstrich geklärt und imaginär aufgebaut. Dennoch arbeitet er – Schicht für Schicht auftragend – an einem Bild mindestens vier bis sechs Wochen.
Am Beginn des (virtuellen) Rundgangs, den der Künstler selbst erläutert, sind Großformate zum „Rattenfänger von Hameln“ zu sehen (genaugenommen kein Märchen, sondern eine Legende). Sie üben einen kaum widerstehlichen Sog in die Bildtiefe aus. Strategien wie etwa der Einsatz von Rückenfiguren, die ins Bild hineinlaufen und so die Betrachtenden „mitnehmen“, erinnern von fern her etwa an Caspar David Friedrich. In diesem Falle ist es, als eilte man als Betrachter den Kindern stracks hinterdrein ins Verderben. Tatsächlich wirken diese Bilder durchaus „bühnenhaft“, man könnte beinahe von selbst ahnen, dass das Theater Fröhlichs Metier ist. Diese Qualität teilt sich sogar online mit. Wie eindringlich müssen die Ölbilder erst wirken, wenn man leibhaftig davor steht? Wahrscheinlich aus der Nähe fast so, als wäre man vom Geschehen umfangen.

Philipp Fröhlich: „Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor“, 2018. Öl auf Leinwand, 195×275 cm (©Philipp Fröhlich)
Eine zweite Serie vergegenwärtigt Szenen aus „Hänsel und Gretel“ – vom fatalen Entschluss der Eltern, die Kinder einfach im Wald zurückzulassen, über das verlockende Hexenhaus bis hin zu Hänsels Käfig-Gefangenschaft und schließlich dem Moment, in dem Gretel die Hexe ins grell lodernde Feuer stößt. Bemerkenswert, wie Fröhlich diese altbekannten, ungemein oft illustrierten Ereignisse in eine zeitgemäße Bildsprache überführt, die zwar im Prinzip gegenständlich bleibt, jedoch mit speziellen Perspektiven, Verwischungen und Andeutungen arbeitet, zuweilen bestürzend nah am Sujet. Es tut sich ein Spannungsfeld zwischen Realismus (z. B. Armutsverhältnisse, Waldnatur) und fiebrig gesteigerter Phantasie auf. Dabei wird die tiefenpsychologische Dimension dieser Vorgänge freigelegt. Man erschrickt, wenn man sich in diesen Bildern umsieht.
Weitere Haltepunkte der Schau sind u. a. Bilder zu „Die sieben Raben“ und zu einem schottischen Märchen („The Hobyahs“), das sich via Australien weltweit verbreitet hat. Da wird ein wachsamer Hund so aus Zorn übers Gebell dermaßen verletzt, dass er nicht mehr vor der rätselhaft dunklen Gefahr warnen kann. Im Märchen aber wird das Tier wundersam wieder zusammengesetzt. Solche Geschichten rufen nach Visualisierung. Zugleich stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit heute noch „narrative“ Bilder möglich sind. Aber ist denn die Zeit des Erzählens vorüber?
Schließlich sind da noch die vier Arbeiten zum kurzen Märchen aus Georg Büchners „Woyzeck“ – vom bitterlich einsamen Kind, dem alle Illusionen über die Welt genommen werden: Der Mond ist nur ein Stück Holz, die Sonne ist eine verwelkte Sonnenblume, die ganze Erde ein umgestürzter Nachttopf. Mit dieser tieftraurigen Reihe, so sagt Philipp Fröhlich, sei seine Werkphase mit Märchenbildern ausgeschritten und abgeschlossen, er werde sich künftig anderen Themen zuwenden. Wohin seine Wege wohl führen werden? Und ob das Märchenhafte spurlos verschwinden wird?
Philipp Fröhlich: „Märchen“. Kunsthalle Barmen, Wuppertal, Geschwister Scholl Platz 4-6. Vom 3. Juni (Fronleichnam, 11-18 Uhr) bis 1. August, geöffnet Do-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €.
Stand 2. Juni: Zum Besuch derzeit k e i n negativer Corona-Test erforderlich. Eintrittskarten mit Zeitfenster zu buchen über www.wuppertal-live.de – Führungen vorerst nur digital.