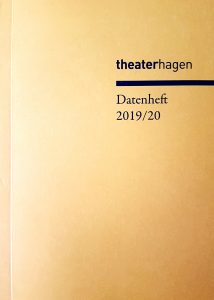Neue Ballettchefin Marguerite Donlon spürt in Hagen dem Mythos Frida Kahlo nach
Frida Kahlo gilt als Ikone der Frauenbewegung: stark, unabhängig, politisch aktiv, sexuell selbstbestimmt. Selbstbewusst bewegt sie sich als Künstlerin zwischen volkstümlich inspirierter Malerei, indigener Symbolik, wagemutigem Surrealismus und reflektierter Selbstinszenierung: eine moderne Figur, die sich selbst erschafft.

Luis Gonzalez und Sara Pena als Diego Rivera und Frida Kahlo. Foto: Oliver Look
Aber sie war auch eine Frau, die unendlich gelitten hat, an Kinderlähmung, an den Folgen eines grauenvollen Unfalls, an beinahe 30 Operationen und an schmerzhaft eingeschränkter Körperlichkeit. Ihren Liebesaffären mit Menschen gleich welchen Geschlechts tat das keinen Abbruch – auch diese von Moral und Gesellschaft unbeeinträchtigte erotische Freiheit lässt sie für uns so zeitgenössisch erscheinen. Zu den Büchern, Theaterstücken und Filmen über Frida Kahlo tritt nun im Theater Hagen der Tanz: Marguerite Donlon gibt mit dem 75-Minuten-Abend „Casa Azul“ ihren Einstand als neue Ballettdirektorin.

Die neue Ballettdirektorin am Theater Hagen, Marguerite Donlon. Foto: Werner Häußner
Es ist eine Choreografie, die 2009 bereits am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken Premiere hatte und anschließend bis 2012 auf Gastspielen in Europa und Asien höchst erfolgreich gezeigt wurde. Ein rundweg gelungenes Werk, denn die gebürtige Irin erliegt nicht der Versuchung, Kahlos Leben in hübschen Bildern nachzuerzählen. Sie versucht zu überwinden, wo die oberflächliche Rezeption hängenbleibt: bei der Pop-Künstlerin und dem feministischen Abziehbild.
Donlons Interesse richtet sich auf die multiple Persönlichkeit der mexikanischen Künstlerin: Drei Tänzerinnen – Noemi Emanuela Martone, Filipa Amorim, Sara Peña – stellen sie, immer wieder auch gleichzeitig, dar. Das Seelenleben zeigt sich in der ausgefeilten Bewegungschoreografie der Körper, das imaginäre, selbstgeschaffenes Gegenüber der Kahlo, aber auch ihre lebensbejahende Fröhlichkeit und ihre äußerlichen Rollen: Frida in der Badewanne, Frida als femme fatale, Frida voll Sehnsucht nach Liebe, Frida als verträumte Künstlerin und als bräutliche Hoheit, Frida mit blutig verletztem Schoß und zum Schluss Frida mit einer Maske, hinter der nur noch der Tod erscheint.
In diesem Spiel mit Camouflage und Entblößung, voll kraftvoller Symbolik, kommt die kreative Aneignung der Gemälde nicht zu kurz. „Die zwei Fridas“ von 1939 werden wörtlich zitiert, das „fliegende Bett“ (1932) hinterlässt seine Spuren, die bunte, ikonenhafte Umkränzung von „Der Rahmen“ (1938) oder auch „Diego und Frida“ (1944) dürften Pate für das Innere der imaginierten „Casa Azul“ gestanden haben. Faszinierend, wie Filipa Amorim im Kleid aus dem Gemälde „Die gebrochene Säule“ (1944) die versehrte, von ihrem Unfall gezeichneten Frau mit ihrem eigenen Körper repräsentiert. Die finale Szene erinnert an „Das Mädchen mit der Totenmaske“ von 1938. Aber die Gemälde sind nicht einfach nur zitiert, sondern in Zusammenhänge verwoben, die von Szene und Tanz entwickelt werden.

Drei Erscheinungsformen derselben Person: Noemi Emanuela Martone, Filipa Amorim und Sara Peña verkörpern Aspekte der Persönlichkeit Frida Kahlos. Foto: Oliver Look
Das Bühnenbild von Ingo Bracke lässt die Hagener Compagnie in einem strengen, kühlen Raum agieren, den er beziehungsreich auch mit intensiven Farben fluten kann oder als Projektionsfläche für Videos und für Zitate aus den Tagebüchern nutzt. Im Vordergrund rieseln leise Kristalle über ein sanft glühendes Häuschen – die „Casa Azul“, das blaue Haus, in dem Frida Kahlo 1907 geboren wurde und 1954 starb. Das Haus, damals eine Oase des Rückzugs, heute als Museum ein Wallfahrtsort, steht noch einmal größer im Hintergrund der Bühne. Von Kahlos zweifachem Ehemann Diego Rivera aufgeklappt, offenbart es sich als Lebensschrein: Umrahmt von Symbolen aus ihren Gemälden, farbenfrohen Blumen, Bildern, Skulpturen, indigenen Symbolen, sitzt Frida vor einem Spiegel, in weißem, rot geblümtem Kleid und mit ihren von Selbstbildnissen bekannten hoch geflochtenen Haaren.

Hinter der Maske erscheint der Tod: Filippa Amorim ujd Darion Rigaglia in „Casa Azul“ in Hagen. Foto: Oliver Look
Auf diese Weise verknüpfen Ingo Bracke und der Kostümbildner Markus Maas die Bildwelt der Künstlerin mit den Szenen auf der Bühne und mit autobiographischen Assoziationen aus den Gemälden. So vertiefen und deuten sie die psychischen Situationen, die sich im Tanz entfalten. Denn bei aller Bildverliebtheit bleibt Donlons primäres Ausdrucksmittel der Tanz, den sie mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eindringlich, ohne akrobatisches Selbstzweck-Gehabe und in expressiver Körperlichkeit ausbreitet, vielfältig gespeist aus Elementen klassischen Balletts und spannungsreichen Ausdruckstanzes bis hin zu pantomimischen Ansätzen und naturalistischen Schauspiel-Skizzen.
Für die fröhlichen Rhythmen von Folklore, verbreiteten mexikanischen Tanzformen und populären Schlagern aus der Zeit Kahlos – teils in historischen Aufnahmen in die Arrangements von Claas Willeke eingearbeitet, teils aus dem Soundtrack des Films „Frida“ von 2002 – entwickelt Donlon auch einmal ein Ensemble ungestüm trivialer Tanzlust; aber die elektronischen Klangwelten, die schwermütigen Tangos und Canciones setzt sie oft in ruhige Gedanken-Figuren der Körper um. Ein Glücksgriff ist Luis Gonzalez, der nicht nur Kahlos zweifachen Ehemann, den Maler Diego Rivera darstellt, sondern live Gesang und Gitarrenmusik beiträgt, zum Teil unterstützt von Alexandre Démont, dessen Cajónes das rhythmische Spektrum reizvoll öffnen. Das Leben als Kunstwerk, Kampf und Lust spiegelt sich in dieser Musik, und Hagen hat einen Ballettabend, der den Besuch lohnt und wohl auch diejenigen überzeugen dürfte, die früheren Tanzhöhepunkten nachtrauern.
Weitere Vorstellungen: 17.11. (18 Uhr); 21.11. (19.30 Uhr); 27.12.2019 (19.30 Uhr); 18.1.2020 (19.30 Uhr); 29.1. (19.30 Uhr); 22.2. (19.30 Uhr); 29.3. (18 Uhr); 18.4. (19.30 Uhr). Karten: (02331) 207 32 18. www.theaterhagen.de