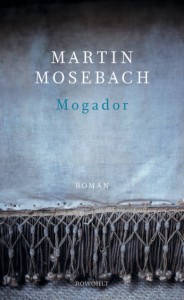Béla Réthy: Zum Schluss ein paar kleine Lektionen

Fußballreprter Béla Réthy im April 2018 bei einer Pressekonferenz. (Wikimedia Commons, © Olaf Kosinsky / http://www.kosinsky.eu / Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)
Staatsaffäre höchsten Ranges: Ein deutscher Fernseh-Fußball-Reporter hört auf. Nach Jahrzehnten. Im ZDF. Béla Réthy. Ach, du meine Güte!
Im WM-Halbfinale Frankreich – Marokko (2:0) hat er seine letzte Messe gelesen. Gottlob gemeinsam mit dem vor nicht allzu langer Zeit emeritierten Ex-Fußballstürmer Sandro Wagner. Der kennt sich nämlich verdammt gut aus und weiß es auch zu kommunizieren. Herrlich, wie dieser Jungspund dem Beinahe-Rentner Béla Réthy auf dessen alte Tage noch ein paar kleine Lektionen erteilt hat, die dieser viel früher hätte gebrauchen können.
Vielleicht wäre Réthy einem ungleich sympathischer gewesen, wenn er einen anderen Job ausgeübt hätte. Synchronsprecher beispielsweise. Mit dieser Kettenraucher-Reibeisen-Stimme. Es hat nicht sollen sein (auch so ein üblicher Reporter-Spruch).
Wie zu lesen war, bekannte sich Béla Réthy bis zum Schluss zur „präsenten Prosa“, sprich: Er wollte spontan reden und mochte sich angeblich nicht groß vorbereiten – anders als der weitaus jüngere, furchtbar eingebildete WC Fuss, der sich auch in den sozialen Netzwerken umtut, bevor er kommentiert. Ungefähr so: „Spieler XY stellt seinen Kumpanen bei Instagram Buchstabenrätsel, schauen Sie mal rein. Es ist lustig.“
Nun ja, Béla Réthy hat sich ebenfalls vorbereitet. Aber eben nach Art seiner Generation. Eher so mit Karteikarten. Old school also. Unvergessen, wie er einst am Mikro das Aussehen eines Spielers mit einer Klobürste verglichen hat. Jetzt bedauert er derlei verbale Eskapaden.
Gerade heute, wo er Spielernamen hätte verwechseln dürfen, hat er es (offenbar) nicht so getan wie sonst. Schön aber, wie er in Katar über die Marokkaner gesagt hat: „Sie sind vielfach hier in Europa geboren.“ Is‘ klar, Béla. Schwamm drüber.
Unvergessliche Brüllwitz-Dialoge auch heute:
Réthy: „Sie (die Franzosen) sind ja auch Weltmeister…“
Wagner: „Du doch auch, oder?“
Réthy: „Noch nicht.“
Vielleicht ja jetzt. Parallel zur Rente. Wie alle, die das Berufsleben weitgehend hinter sich haben. Lauter Weltmeister.
Beide tippten übrigens auf Frankreich als neuerlichen Titelkandidaten. Messi hin, Messi her. Wir werden sehen.
Geradezu rührend Réthys Altersmilde: „Wir verteilen hier keine gelben Karten.“ Stimmt auffallend. Dafür sind tatsächlich andere Leute zuständig.
Schließlich dann doch noch der Köpper ins Klischee. Da die arabische Welt massiv beteiligt war, musste noch der Kracher von „1001 Nacht“ rausgehauen werden. Ehrensache. In diesen Kreisen. Neulich hat noch ein erbarmungswürdiger Kollege zu den Argentiniern „Dann Gute Nacht, Gauchos“ gesagt. Wie einst Heribert Faßbender. Aber 2022. Ich glaube, es war einer von „Magenta TV“ („Mehr WM geht nicht.“). Da sehnt man sich im Voraus fast schon nach Béla Réthy zurück.
Und was ist jetzt mit hundsgemeinen Facebook-Gruppen wie „Béla Réthy gefällt mir nicht“? Nun, irgendwen werden sie schon als Nachfolger(in) finden.
Nicht, dass uns am Ende doch noch seine Stimmlage fehlen wird…