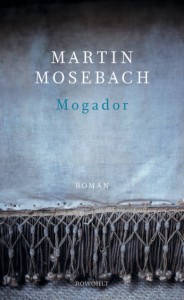Der Maler, der die Frauen zerstört – Martin Mosebachs Roman „Die Richtige“
Louis Creutz ist ein Maler, der nach anfänglicher Mühsal längst internationalen Erfolg hat. Er lässt nur noch eigene Maßstäbe und Perspektiven gelten, die er häufig dozierend in gewundenen Sentenzen ausbreitet. Überdies betrachtet er sich selbst in jeglicher Hinsicht als unabhängig. Etliche Frauen zeigen sich davon beeindruckt.
Seine langjährig treuesten Käufer und Mäzene heißen Beate und Rudolf, Letzterer ist Mitinhaber einer weltweit operierenden Hydraulik-Firma. Deren Geschäfte führt vor allem sein Bruder Dietrich, ein unscheinbarer Mensch, der jedoch durch Beständigkeit und Verlässlichkeit ungemein gewinnt. Seine Abgründe, die es durchaus zu geben scheint, werden durch bescheidene Liebenswürdigkeit ausbalanciert.
Damit hätten wir bereits wesentliches Personal aus Martin Mosebachs neuem Roman „Die Richtige“ beisammen. Die den Titel inspirierende Frau kommt hinzu: Es ist jene, vermeintlich etwas naive, jedenfalls ausnehmend hübsche, munter plaudernde und bis dato grundsätzlich lebensfrohe Halbschwedin Astrid, die eines Tages in diese begüterten Kreise gerät. Opernsängerin hat sie einst werden wollen. Nun arbeitet sie in einem Intendanten-Büro. Aber das nur nebenbei.
Zunächst langsam, dann aber fatal gerät die Handlung in Gang, als der Künstler jenen Dietrich und Astrid in einem abgekarteten Spiel zusammenbringt, bis sie tatsächlich zueinander finden und heiraten. Eine ungleiche Allianz? Nein, es scheint sich wundersam zu fügen. Doch dann die Versuchung und Verstrickung, die Gift ins scheinbar beruhigte Glück träufelt: Während Dietrich wochenlang geschäftlich in China unterwegs ist, kann Louis Creutz nicht widerstehen und will – uraltes Motiv der Künste – Astrid als ideales Aktmodell recht eigentlich „besitzen“. Das Widerstreben währt nicht lange, sie lässt sich darauf ein. Sitzung folgt auf Sitzung, bis das offenbar „Unvermeidliche“ geschieht. Aus der Gemengelage zwischen Maler und Modell erwächst dann freilich unversöhnlicher Streit, der schließlich in eine Tragödie von zermalmender Wucht mündet.
Rückblicke offenbaren des Künstlers seit jeher zerstörerische Wirkung. Seine rasend eifersüchtige Ex-Frau Ira ist erloschen auf der Strecke geblieben, sein langjähriges Modell Flora Ortiz ist vollends entgleist und geistert vogelfrei als obdachlose „Ver-rückte“ durch die Stadtlandschaft. Zerstörerisch auch die Auswirkungen auf Astrid. Details dazu seien hier verschwiegen, sie würden den Spannungsbogen bei der Lektüre erheblich mindern.
Derweil leugnet Creutz jeden Zusammenhang zwischen seinem Leben und den künstlerischen Resultaten, die angeblich den Niederungen des Alltags enthoben sind und nur den ewigen Gesetzen der Kunst gehorchen. An biographischen Nachforschungen eines Galerie-Mitarbeiters namens Rucktäschel mag er denn auch nicht mitwirken, er nennt ihn eine „Archivwanze“. Wo käme der selbstgerechte Malerfürst denn hin, wenn er sich schnöden Ursachen oder womöglich gar einer Verantwortung stellen müsste! Ja, man könnte diesen Louis Creutz von Herzen verachten, doch man hüte sich vor Eindeutigkeit. Von Zeit zu Zeit erlaubt sich der Künstler – im Gefolge seines Schulfreundes Ed Weiss – Ausflüge ins klein- bis mittelkriminelle Milieu. Es könnte ja einmal nützlich sein…
Martin Mosebach erzählt abermals ausgesprochen gediegen, meisterlich gliedernd und zergliedernd, vergleichsweise konventionell bis konservativ, stets hochkulturell grundiert. Es ist sozusagen Bildungsliteratur, die mal an die Übergröße Thomas Mann, mal auch an Martin Walser zu dessen besten Zeiten gemahnt. Auch dürfte etwas von Goethes „Wahlverwandtschaften“ als Muster durchscheinen. Auf viel geringeren Höhen sollte man nicht über Mosebach reden. Seinem Duktus kann man sich lesend gut und gerne anvertrauen. Er geleitet uns trittsicher, sprachmächtig u n d mit angenehmer Diskretion durch die Kältezonen der Kunstwelt ebenso wie durch Brutalitäten im Jagdrevier oder Abgründe des Begehrens.
Martin Mosbach: „Die Richtige“. Roman. dtv. 348 Seiten. 26 Euro.