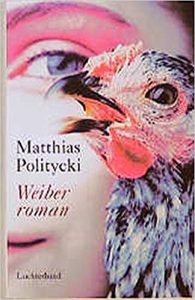In der Fremde soll man sich ändern – Matthias Polityckis anregendes Buch über das Reisen
Auf der Rückseite des Umschlags steht es abermals: Matthias Politycki (Jahrgang 1955) wird gelegentlich als Abenteurer und Draufgänger der deutschen Gegenwartsliteratur bezeichnet. Das mag ja stimmen. Fest steht jedenfalls: Der Mann ist ungeheuer viel und zuweilen recht riskant gereist – bis in die letzten Weltwinkel. Davon legt er in seinem neuen Buch beredtes Zeugnis ab.
 Der längliche Titel zieht schon entsprechend weite Horizonte auf: „Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken“ heißt der Band, der wirklich auf ausgesprochen vielfältigen Reiseerfahrungen basiert. Auch die allermeisten Backpacker dürften auf vergleichsweise ausgetretenen Pfaden unterwegs sein. Von verwöhnten Individual- oder Pauschaltouristen ganz zu schweigen.
Der längliche Titel zieht schon entsprechend weite Horizonte auf: „Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken“ heißt der Band, der wirklich auf ausgesprochen vielfältigen Reiseerfahrungen basiert. Auch die allermeisten Backpacker dürften auf vergleichsweise ausgetretenen Pfaden unterwegs sein. Von verwöhnten Individual- oder Pauschaltouristen ganz zu schweigen.
Wo ist nur die alte Freiheit geblieben?
Gleich eingangs benennt Politycki ein Grundproblem heutigen Reisens, das – von Ausnahmen abgesehen – bis vor einiger Zeit noch relativ ungebrochen als Synonym für Freiheit gegolten hat. Jetzt freilich, unter dem Eindruck von Krieg, Terror, Globalisierung und weltweiten Flüchtlingsströmen, habe sich ein tiefer Bedeutungswandel vollzogen. „Reisen hat seine Unschuld verloren“. Sagen wir mal: spätestens jetzt, vielleicht für alle restliche Zeit.
Die einst als „Exotik“ wahrgenommene Fremde könne nun bereits beginnen, wenn wir aus der heimischen Haustür gehen. Andererseits gebe es „da draußen“, also rund um den Erdball, oft nichts grundsätzlich „Anderes“ mehr zu entdecken. Da stellt sich die Frage, was denn eigentlich authentisch sei. Vielleicht gar nichts? Oder eben alles. Auf seine Weise. Doch trotz wachsender Bedenken treibt es Politycki immer wieder hinaus in die Ferne. Es ist eine unstillbare Sehnsucht.
Immer neue Bewährungsproben
Aber keine Angst. Politycki theoretisiert und reflektiert natürlich nicht nur, er wird sozusagen tausendfach konkret und schöpft freigebig aus dem reichen Reservoir seiner Erfahrungen. Dabei geht es vor allem um die Haltung des Reisenden, der sich in verschiedenen Weltgegenden jeweils ganz anders benehmen und bewähren müsse, nirgendwo jedoch unterwürfig.
Auf Reisen, so Politycki, treffe man vor allem Menschen aus der Unterschicht der jeweiligen Länder. Daher müsse man sich – zumal als Alleinreisender – handfest und selbstbewusst behaupten, notfalls gar hart auftrumpfen, um nicht unterzugehen und seine Würde zu wahren. Da man sich – auch mit Englisch – längst nicht überall verständlich machen könne, müsse man sich dafür auch eine angemessene Körpersprache zulegen.
Ist das ein Beispiel neudeutscher Überheblichkeit? Wohl kaum. In entlegenen Gebieten unterwegs, muss man sich schon so mancher Zudringlichkeit zu erwehren wissen, diese Einsicht vermittelt Politycki sehr glaubhaft. Ansonsten ist er jederzeit bereit, seine Urteile zu korrigieren, zu relativieren und neu zu fassen. Eben das sollte ja eine Frucht wirklichen Reisens sein.
Auch Müllberge und Slums nicht gemieden
Mit wohlmeinender politischer Korrektheit, so der Autor, komme man jedenfalls nicht weit. Und überhaupt: „Je weiter er in der Welt herumgekommen ist, desto schwerer wird es dem Reisenden fallen, zu übergreifenden Meinungen und Etikettierungen zu gelangen.“ Somit erweist sich intensives Reisen auch als permanente Verunsicherung.
Touristische Stätten erscheinen dem erfahrungshungrig Suchenden in aller Regel als Enttäuschungen, als hoffnungslos überfüllte Plätze, an denen „sich die Weltjugend zum Posen trifft“ und Millionen Selfies knipst. Der Autor hingegen scheut sich nicht, beispielsweise indische Müllberge zu besteigen, um auch diese abscheuliche Seite des ungeheuren Subkontinents am eigenen Leibe zu erfahren. Ebenso ist er (notgedrungen „kalten Blickes“) durch etliche Slums gezogen, um alle Stufen des Elends zu sehen und also vor der furchtbaren Wirklichkeit nicht die Augen zu verschließen. Es ist sicherlich kein zynischer Voyeurismus, der ihn treibt, sondern Erkenntnisdrang. Das darf man ihm glauben.
Wer so unbedingt reist, kommt zwangsläufig in extreme, manchmal auch gefährliche Situationen, in physische und psychische Grenzbereiche – ob nun in Nepal, Samarkand, Ruanda, Lateinamerika oder Japan, um nur ganz wenige Zielgebiete zu nennen.
Wo gibt es die besten Barbiere der Welt?
Politycki erzählt von all dem sehr anschaulich und keineswegs mit dem Gestus des Eroberers oder Triumphators. Er erwähnt auch manche Peinlichkeit, manche „Niederlage“ in der Fremde. Es sind buchstäblich Erfahrungen fürs Leben. In der Fremde ist man zuweilen rundum gefordert, kann und muss man ein Anderer werden, sich neu erproben. Das fängt schon mit äußerlichen, nur scheinbar „banalen“ Dingen wie dem indischen Straßenverkehr oder dem japanischen Straßensystem an.
Anregend sind auch einige Exkurse wie etwa der aufschlussreiche Vergleich von Barbier-Besuchen in verschiedenen Ländern. Der Autor greift nach und nach zahllose Aspekte des Reisens auf und zitiert dabei, um den Kreis nochmals zu erweitern, en passant nicht nur große Reiseschriftsteller wie etwa Bruce Chatwin, sondern auch ähnlich reisesüchtige Gefährten und Freunde.
Ein gewisser Überdruss gehört irgendwann dazu
Als Signale vom Gegenpol liest man in diesem Kontext Zeilen des Reise-Skeptikers Gottfried Benn: „Ach, vergeblich das Fahren! / Spät erst erfahren Sie sich: / bleiben und stille bewahren / das sich umgrenzende Ich.“ Nein, dieser Stubenhocker! Doch den Überdruss am Reisen, das Gefühl, alles schon (eindrucksvoller) gesehen zu haben, den kennt selbstverständlich auch Politycki.
Unterdessen fragt man sich, wann und wie Politycki neben den Reisen überhaupt noch die Zeit zum Bücherschreiben aufgebracht hat. Egal. Er hat’s ja mal wieder geschafft. Dieses mit Erfahrung gesättigte, durchlebte und durchdachte Buch kann die Einstellung zum Reisen und damit zum Dasein ändern. Es gehört ins Regal – oder besser noch: gleich ins Reisegepäck.
Matthias Politycki: „Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken“. Hoffmann und Campe. 351 Seiten. 22 €.