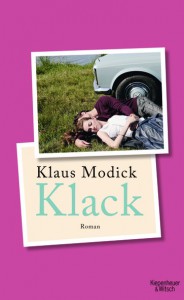Neuer Mauerbau, Stalins Schatten und der Terror des Digitalen – zum umstrittenen DAU-Kunstprojekt in Berlin
Vor 29 Jahren fielen in Berlin die Mauer und der „Eiserne Vorhang“. Das war der Auftakt vom Ende des Realen Sozialismus und einer Diktatur des Proletariats, die immer nur ein ideologischer Popanz war, mit dem sich schamlose Partei-Bonzen der herrschenden Nomenklatura die Macht über das Volk sicherten. Neben einigen unverbesserlichen Nostalgikern, die sich gern die schlechte Vergangenheit schön reden, gibt es jetzt auch einige Künstler, die vom (temporären) Wiederaufbau der Mauer träumen.
Direkt in Berlins Mitte, in einem etwa 300 mal 300 Meter großen, von einer russischen Beton-Mauer abgeriegelten Areal zwischen Staatsoper und Bauakademie, soll direkt an der Straße Unter den Linden vom 12. Oktober bis 9. November ein neo-stalinistisches Menschenexperiment durchgeführt werden, das sich als freiheitliches Kunst-Projekt tarnt und den Besuchern neue und ungeahnte Möglichkeiten der Wahrnehmung und Partizipation verspricht.
Erlebniszone mit „historischen Echoräumen“
Unter dem kryptischen Kürzel „DAU Freiheit“ wird, so lassen die als Mitveranstalter auftretenden Berliner Festspiele verlauten, eine „Zone markiert, die für vier Wochen zu einem besonderen Erlebnisraum wird“, „historische Echoräume öffnet“ und angeblich die Chance bietet, „eine politisch-gesellschaftliche Debatte über Freiheit und Totalitarismus, Überwachung, Zusammenleben und nationale Identität zu eröffnen.“
Wer denkt, das klinge arg nach politischer Überhöhung eines künstlerisch größenwahnsinnigen Projekts, liegt wohl nicht ganz falsch. Doch worum geht es eigentlich beim „DAU“-Projekt, dieser seltsamen Mixtur aus Performance und Reality-Show, die in Berlin unter dem Begriff „Freiheit“ auftritt, bevor sie – entschlackt und ohne Mauer – weiter zieht und in Paris als „Gleichheit“ und in London als „Brüderlichkeit“ für verwirrte Gemüter sorgen wird?
Auf den geheimnisvollen Spuren des Physikers Lev Landau
Mit der Französischen Revolution und ihren hehren Idealen hat „DAU“ jedenfalls nichts zu tun. Eher schon mit der Negation der Digitalmoderne, die hinter der Maske der totalen Transparenz den gläsernen Menschen schafft. Namensgeber des Projekts ist der russische Physiker und Nobelpreisträger Lev Landau (1908-1968), der von seinen Freunden „Dau“ genannt wurde und in Moskau ein streng geheimes „Institut für Physikalische Probleme der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften“ betrieb.
Um dem Rätsel des geheimnisumwitterten Physikers auf die Spur zu kommen, ließ der russische Regisseur Ilya Khrzhanovsky im ukrainischen Charkiw, wo Landau eine zeitlang lebte und arbeitete, ein gigantisches, 12.000 Quadratmeter großes Filmset aufbauen: einen eigenen, von Zäunen begrenzten Stadtteil, in dem von 2009 bis 2011 über 400 Menschen lebten und das – mit allen Mitteln des Terrors und der Totalüberwachung – so funktionierte wie Stalins Machtimperium.
…und die Kamera war immer dabei
In Charkiw wurde drei Jahre lang geforscht und geliebt, wurden Experimente durchgeführt und Kinder gezeugt. Und die Kamera von Jürgen Jürges, der früher mit Fassbinder und Wenders drehte, war immer dabei. Kunst-Performerin Marina Abramovic war zu Gast und Regisseur Romeo Castellucci, Pop-Musiker von Massive Attack und Star-Dirigent Theodor Currentzis. Aus dem so entstandenen Film-Material sollen 13 Spielfilme und eine Vielzahl von Mini-Serien geschnitten worden sein. Nichts Genaues weiß man nicht, alles liegt im Dunkeln der künstlich angeheizten Gerüchteküche.
Jetzt sollen die Filme im temporären neuen Berliner Mauer-Staat „DAU Freiheit“ vier Wochen lang präsentiert werden. Dazu soll es Performances und Lesungen, Konzerte und Vorträge, Einzelgespräche und Überraschungen geben. Mit dabei sollen auch wieder Abramovic und Co sein. Doch wer was wann wo vorführt, darüber herrscht (noch) Schweigen. Klar scheint bisher nur, dass im ganzen Kunst-Areal das alte DDR-Flair wieder auflebt, schlechte Beschilderung und dunkle Beleuchtung, muffiger Geruch und beklemmende Atmosphäre wie weiland im Mangel-Staat.
Reanimation des Realsozialismus‘
Wer die neo-sozialistische Reanimation betreten will, muss vorher einen Fragebogen ausfüllen und ein Visum beantragen und dann beim Passieren der Mauer sein Handy abgeben. Dafür bekommt er ein Gerät namens „DAU-Device“, das den Besucher zu den einzelnen Programmpunkten führt: Einlass nur auf Einladung durch das Gerät.
Wer dem Kunst-Terror nicht gewachsen ist, kann ein Notsignal senden und sich befreien lassen. Die Anwohner des Mauer-Parks werden zu „Ehrenstaatsbürgern“ erklärt, haben eigene Zutritts-Möglichkeiten zum Überwachungsstaat und können sich in ihrem angestammten Wohnraum frei bewegen. Ob das ganze Treiben wiederum von Khrzhanovsky und Jürges filmisch begleitet und später in einen neuen Streifen über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einfließt, ist noch unklar.
Auch ein russischer Oligarch finanziert das Ganze mit
Klar ist nur, und das macht die bizarre Angelegenheit nicht schmackhafter, dass neben den Berliner Festspielen auch Sponsoren das Projekt finanzieren, die nicht gerade ein guten Leumund haben, wie der russische Oligarch Sergej Adonjew. Auch dass es beim Dreh in der Ukraine sexuelle Übergriffe von Seiten des Regisseurs gegeben haben soll, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack.
Die Kunst ist frei und wird auch den Größenwahn dieses Menschenexperiments und den Terror des temporären Mauer-Staates ertragen. Der schlimmste Feind der Kunstfreiheit ist aber die Bürokratie: Der Bau einer Mauer und das Leben in einem von eigenen Gesetzen bestimmten Erlebnisraum brauchen Genehmigungen von Bau- und Gewerbeamt, Polizei, Feuerwehr. Die stehen noch aus. Könnte also sein, dass sich alles noch als Luftnummer erweist und alle Kunst-Träume zerplatzen wie heiße Ballons.
________________________________________________________
„DAU Freiheit“, vom 10. Oktober bis 9. November 2018.
Ein genaues Programm existiert (noch) nicht, auf dem 300 mal 300 Meter großes Areal und in den kooperierten Häusern und Akademien am Boulevard Unter den Linden sind Filmvorführungen des 700 stündigen DAU-Filmmaterials, Kunst-Performances, Auftritte von Musikern, wissenschaftliche Vorträge u.a. geplant.
Besucher(innen) registrieren sich auf der „DAU-Webseite“, um ein Visum zu erwerben.
Täglich können bis zu 3000 Visa ausgegeben werden. Ein Zwei-Stunden-Visum kostet 15 Euro, ein Tagesvisum 25 Euro, ein 72-Stunden-Visum 45 Euro. Es soll auch Diplomaten- und Presse-Visa geben, die für die gesamte Laufzeit gelten und Zutritt zu allen Veranstaltungen gewährt.
Infos unter www.berlinerfestspiele.de
https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/dau_freiheit/dau_freiheit_1.php