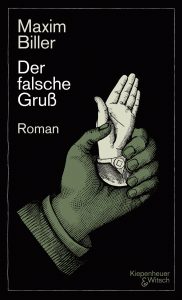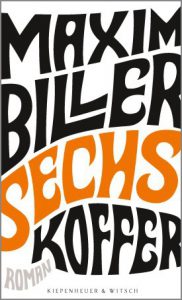Geschichtlicher Spuk – Maxim Billers Roman „Der falsche Gruß“
Junger Mann namens Erck Dessauer drängt als kommender Autor zum führenden Edelverlag, doch der dort längst etablierte, allseits hofierte Großschriftsteller und jüdische Intellektuelle Hans Ulrich Barsilay scheint ihn daran hindern zu wollen. Nanu?
Gleich zu Beginn begibt sich dieser Skandal, als wär’s eine Phantasmagorie: In einer irrsinnigen Aufwallung zeigt Dessauer diesem Barsilay und dessen eingeschworener Entourage so etwas wie einen zittrigen Hitlergruß. Ein hochnotpeinlicher Moment im Berliner Lokal „Trois Minutes“. Ganz gleich, ob Dessauer damit die vermeintlichen Machtspiele des anderen provokant kenntlich machen wollte: Die gänzlich verunglückte Geste dürfte doch wohl das Ende all seiner Ambitionen bedeuten. Mit seinem publizistischen Einfluss wird Barsilay ihn nun gewiss gesellschaftlich vernichten, oder? Wir werden nun Zeugen einer unkontrolliert anschwellenden Furcht.
In der Villa des Hitler-Vertrauten
In seinem neuen Roman „Der falsche Gruß“ vollführt Maxim Biller mancherlei Zeitsprünge und verquickt manches mit manchem. Einen Altnazi-Großvater. Die Auflösung der DDR. Flüchtlings-„Schicksale“ daselbst. Jüdische Identität im heutigen Deutschland. Intrigen im Literaturbetrieb und im Verlagswesen. Herausgehobene Protagonistin ist die Verlegerin, die sich in einer ehemaligen Villa des Hitler-Vertrauten Martin Bormann hochherrschaftlich eingerichtet hat. Zudem geht’s um Berliner Befindlichkeiten als Brennglas komplizierter deutscher Zustände. Oder ist das alles ein zirzensischer Bühnenzauber mit parodistischem Einschlag? Nun, eher ist es vielfältiger historischer Spuk, der keine Ruhe geben will.
Wer die Arbeitslager perfektioniert hat
Sein Antipode Barsilay, so will es dem stets vorauseilend beleidigten Dessauer jedenfalls scheinen, ist zu allem Überfluss wohl drauf und dran, ihm das Thema wegzuschnappen. Dessauer schickt sich an, ein Buch über Naftali Frenkel zu schreiben, jenen erzkriminellen Abenteurer aus jüdischer Familie, der eines Tages Stalins Aufmerksamkeit auf sich zog, weil er teuflische Vorschläge zur „Rationalisierung“ und Perfektionierung der sowjetischen Arbeitslager gemacht und später selbst umgesetzt hat: Nahrung nur noch für einstweilen nützliche Kräfte, die anderen kann man ja mit winzigen Rationen Hungers sterben lassen. Im Raum schwebt somit die heikle Frage, ob ausgerechnet Frenkel – vor allen Nazis – als „Erfinder“ der Konzentrationslager gelten kann, so dass Ernst Noltes höchst umstrittene These vom NS-Staat als Reaktion auf den Stalinismus neue Nahrung bekäme. Gefährlich vermintes Debatten-Gelände. Aber Hauptsache, Dessauers Buch kommt heraus…
Was sind das nur für Ränkespiele?
Irgendwann hat sich ja auch der Knoten gelöst – und es schwinden die seit dem „falschen Gruß“ virulenten Angstattacken Dessauers. Warum? In Barsilays überall hochgelobtem Buch „Meine Leute“, dem auch er nicht seine Bewunderung versagen konnte, hat Erck Dessauer eine Passage entdeckt, in der jener seine schockhafte Erschütterung beim Besuch der Auschwitz-Gedenkstätte schildert, ja geradezu als entscheidende Lebenswende zelebriert. Dessauer findet heraus, dass es sich bei den näheren Umständen um Erfindung handeln muss, ja, dass Barsilay nicht einmal in Polen gewesen ist. Also hat er jetzt etwas Gewichtiges gegen seinen Widersacher in der Hand, das die Sache mit dem Hitlergruß womöglich aufwiegt. Auschwitz und der deutsche „Kult“ um den Holocaust, so sein zwiespältiger Befund, verzeihen keine Lügen. Aber wer lügt und belügt sich hier eigentlich am meisten? Und überhaupt: Was sind das für irrwitzige Ränkespiele, wo es doch inhaltlich um die schlimmsten Verbrechen der Geschichte geht?
Womöglich auch noch ein Schlüsselroman
Und sonst? Haben wir auch hier einen Hauch vom Ewigweiblichen, das hinan und hinab ziehen kann. Im Tross des Hans Ulrich Barsilay (solch ein Name aber auch!) bewegt sich zeitweise die aufreizende Russin Valeria, die selbst der sonst erotisch nur schwer ansprechbare Dessauer (vergebens) zu begehren scheint. Mittlerweile hat Barsilay in einem Buch mit dem Titel „Lustlos“ Valeria sexuell bloßgestellt, worum sich Gerichtsverfahren ranken – ein juristisches Feld, auf dem auch Maxim Biller mit „Esra“ so seine Erfahrungen gesammelt hat. Doch auch das bleibt Episode, wie so vieles in diesem Roman-Konstrukt, in dem schon mal solche Sätze ‚rausgehauen werden: „Freundschaften, das fand ich schon lange, waren nur etwas für Frauen und Verlierer.“ Klingt halt obercool.
Ist „Der falsche Gruß“ am Ende etwa auch noch ein Schlüsselroman über eine real existierende Welt des Scheins, über gewisse intellektuelle Kreise und Figuren der deutschen Hauptstadt? Mag sein. Aber vielleicht sollten kundige Herrschaften in Berlin das Rätsel unter sich ausmachen. Es ist ja gar nicht so furchtbar spannend. Und wer weiß, ob Biller nicht auch hiermit sein Verwirrspiel treibt.
Ganz ehrlich: Ich habe mich eher missmutig durch die bisweilen raffiniert verknüpften, streckenweise aber auch wirr verschlungenen Handlungsmuster des doch eigentlich recht kurzen Romans gequält. Vielleicht finde ich einfach keinen Zugang zu Billers Schreibweise, die mir – bei all seiner funkelnden Intelligenz und polemischen Potenz – zumindest unterschwellig arrogant und anmaßend vorkommt. Tja. Das wäre dann im Grunde m e i n Problem, nicht wahr?
Maxim Biller: „Der falsche Gruß“. Roman. Kiepenheuer & Witsch. 128 Seiten, 20 Euro.