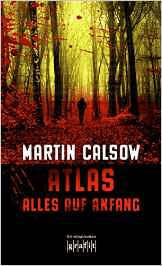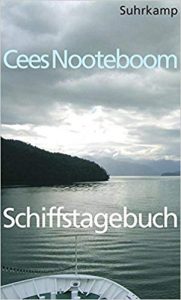Flucht vor dem Drogenkartell – in die gar nicht so idyllische Provinz
Das seit Jahren vermisste Mädchen Gesa war für die meisten Bürger in dem beschaulichen Bad Iburg längst in Vergessenheit geraten, als Andreas Atlas plötzlich wieder in dem Städtchen mitten im Teutoburger Wald auftaucht. Er hatte sich einst kurz nach dem Verschwinden der damals 18-jährigen aus dem Staub gemacht. Als er nun in seine alte Heimat zurückkehrt, holt ihn die Vergangenheit wieder ein, aber nicht nur ihn, sondern auch Bekannte und Kollegen aus früheren Zeiten.
Andreas Atlas ist die Hauptfigur in Martin Calsows neuem Krimi, der von sehr unterschiedlichen Handlungssträngen lebt und recht eigenartige Persönlichkeiten aufzubieten hat. Das fängt schon bei Atlas selbst an. Er ist ein Mann des Bundeskriminalamtes, war als verdeckter Ermittler auf das mexikanische Drogenkartell angesetzt. Ihm gelingt zwar dort der Aufstieg, aber als er auffliegt, muss der Deutsche fliehen.
Dabei möchte er sich eigentlich mit einem unterschlagenen Millionenvermögen in Südamerika ein schönes Leben machen. Doch aus Todesangst vor seinen Verfolgern sucht er lieber den Schutz der ländlichen Idylle. Dort kann indes von Wiedersehensfreude keine Rede sein, die eigene Familie fühlt sich von ihm verprellt, da er es nicht einmal für nötig befand, zur Beerdigung des Vaters zu erscheinen. Das hat auch auf seinen Ruf im Ort abgefärbt, zudem glauben die meisten Leute ohnehin, er habe sich nur rumgetrieben und sei ein Scharlatan.
Doch eine Freundin aus alten Zeiten hält zu ihm. Mit ihr gemeinsam rekonstruiert er die letzten Tage und Stunden vor Gesas Verschwinden. Dass da plötzlich noch intime Fotos auftauchen und Menschen in den Fokus geraten, die sich bis dahin als streng religiöse Gläubige ausgewiesen haben, trägt ganz erheblich zur Steigerung des Spannungsbogens bei. Calsow versteht es nicht nur, dem Krimi eine dramatische Wende zu verleihen, es gelingt ihm auch, die Charaktere mit ihren Widersprüchlichkeiten und prägenden Lebensschicksalen prägnant zu beschreiben.
So aufwühlend die Ereignisse von damals und heute auch immer sein mögen, Atlas verliert nie seine prekäre Lage aus den Augen. Was aus seinen ursprünglichen Zukunftsplänen wird, sei hier noch nicht verraten. Wohl aber soviel: Wie es mit ihm weitergeht, wird ganz wesentlich von einem autistischen Kind bestimmt.
Martin Calsow: „Atlas. Alles auf Anfang“. Grafit Verlag, 253 Seiten, 10,99 Euro.