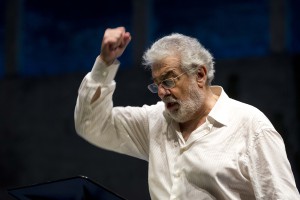Wer hat die Nase vorn? „Parsifal“ in Düsseldorf und Hannover

Szene aus dem dritten Aufzug des „Parsifal“ in Düsseldorf mit Daniel Frank (Parsifal) und Sarah Ferede (Kundry). (Foto: Sandra Then)
In Düsseldorf steht er mit leeren Händen im gleißenden Licht, der neue Gralskönig Parsifal. In Hannover bleibt von den Wirrnissen der Ritter- und der Klingsor-Welt ein Kind übrig. Erlösung wird der Welt in beiden Inszenierungen nicht zuteil. Die Sicht auf Richard Wagners „Bühnenweihfestspiel“ ist pessimistisch, bei allen Unterschieden. Und die sind markant, in der szenischen wie in der musikalischen Gestaltung.
Die Premiere in Düsseldorf bringt den viel gelobten „Parsifal“ aus Genf an den Rhein, in einer minimalistischen Regie von Michael Thalheimer, der in der letzten Spielzeit einen faszinierenden Verdi-„Macbeth“ an der Deutschen Oper herausgebracht hat. Auf der Drehbühne (Henrik Ahr) ein Podest, abgeschlossen nach hinten durch eine mittig vertikal geteilte, schmutzigweiße Wand, horizontal gegliedert durch einen Querbalken. So ergibt sich ein Kreuz, einziger Hinweis auf die christlichen Konnotationen von Wagners Weltabschiedswerk.
Der künftige Erlöser schreitet strahlend weiß aus diesem Spalt auf eine Fläche, auf der Gurnemanz, ein stattlicher, gebrochener Mann, allzu hörbar schlurfend seine Runden dreht. Bis zu den Hüften muss er einmal im Blut gestanden haben – so wirkt jedenfalls sein schwerer Mantel. Das Blut holt alle ein: Die Gewänder von Michaela Barth, in denen die Gralsritter geistern, sind rot verschmiert; Kundry malt im dritten Aufzug unentwegt den Kernsatz des Werks wie eine Beschwörungsformel an die Wand: „Durch Mitleid wissend der reine Tor. Parsifal“. Die Sphäre Klingsors ist schwarz und vertikal gebrochen – die Rückseite der Welt der Gralsgesellschaft.
Woher das Blut, woher die Schuld? Thalheimer verweigert die Antwort, so wie er seinen „Parsifal“ überhaupt strikt von Deutung frei hält und damit bisweilen Bedeutung gefährdet. Mit den Mitteln minutiöser Personenführung und der peniblen Planung von Gesten und Gängen schafft Thalheimer ein zugespitztes Kammerspiel, das die Gefahr öder Langeweile bannt, weil die Figuren auch durch die szenische Konzentration der Darsteller selbst in langen Passagen gesungener Texte spannend und lebendig bleiben. Dieser „Parsifal“ hat viel mit der Magie des Spielens zu tun und ist deshalb auch ein Stück faszinierendes Schauspieler-Theater.
Vollgepackte Bühne in Hannover
Der Kontrast zu Hannover könnte nicht größer sein: Dort inszeniert einer der neuen Mode-Regisseure, der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson, designiert für „Tristan und Isolde“ in Bayreuth 2024. Er schafft es, auf der vollgepackten Bühne von Wolfgang Menardi trotz ausgiebigen Einsatzes von Licht, Nebel und Personal langatmige Ödnis zu verbreiten. Auch bei Arnarsson gibt es verlangsamte Bewegung, wankende Choraufmärsche wie weiland bei Wolfgang Wagner, aber auch Schreiten und Stolpern, Holpern und Rennen, dazu einen nervigen Umbau bei offener Bühne, ein auf- und abfahrendes Gerüstpaneel mit Neonröhren über einem rätselhaften Becken, und verkohlte Baumstämme, die uns die wie auch immer geartete Katastrophe signalisieren und am Ende des ersten Aufzugs erwartungsgemäß nach oben entschweben.

Irgendwie Katastrophe: Die Bühne von Wolfgang Menardi für den „Parsifal“ in Hannover, hier mit Marco Jentzsch (Parsifal) und Shavleg Armasi (Gurnemanz). (Foto: Sandra Then)
Im Klingsor-Akt umschließt ein weißer Kasten eine steril-museale Landschaft, bevölkert von lethargischen Frauen mit aufgemalten primären Geschlechtsmerkmalen auf halbtransparenten Verschleierungen (Kostüme: Karen Briem). Das Gespräch zwischen Parsifal und der unruhig auf und ab tigernden Kundry wird zum finalen Durchhänger eines mit geschäftigen Leerläufen gesegneten Abends. Der im Interview im Programm zitierte C.G. Jung mag erklären, warum Arnarsson Amfortas und Klingsor vom selben Sänger – dem energisch, rotzig und gewalttätig, aber auch erbarmenswert schmerzvoll singenden Michael Kupfer-Radecky – verkörpern lässt. Aber die zentrale Idee der Regie wirkt trotz Psychologie als bloße Bedeutungs-Behauptung: Parsifal erscheint als Kind, junger Erwachsener und reifer Mann, um seine Entwicklung erfahrbar zu machen. Doch die Doppelungen und Mehrfachauftritte von Sänger Marco Jentzsch mit den Kindern Maximilian Blossfeld und Leandro Klyszcz vermitteln keine konzentrierte Erzähllinie.

Steril und ohne Blumenzauber: Klingsors Welt in Hannover. Im Zentrum Michael Kupfer-Radecky. (Foto: Sandra Then)
Was am Ende des Assoziationstrubels bleibt, als die blendende Weißlichtfläche, die wohl den „Gral“ symbolisieren soll, endgültig zur Hölle gefahren ist und die Gralsritter ihre Hörnerhüte – eine Assoziation an Hägar-der-Schreckliche-Helme und Frickas Widder – abgelegt haben, bleibt unklar. Die Sinnlosigkeit jeder Entwicklung? Das Kind – der Anfang der immergleichen Geschichte? Das Panorama vergeblicher menschlicher Versuche, der Akzeptanz des immerwährenden Leids der Welt zu entkommen? Das Gefühl der Erlösung jedenfalls wird nur in der erleichterten Erkenntnis spürbar, dass der Abend endlich zu Ende geht.
Spannungsreiches Klangbild
Musikalisch allerdings hätte er noch länger dauern dürfen, denn der Hannoveraner GMD Stephan Zilias spornt das vorzüglich auf Wagner eingestellte Niedersächsische Staatsorchester zu einem lebendigen und spannungsreichen Klangbild an. Man mag über das eine oder andere langsame Tempo an der Grenze zum Zähen streiten, man mag manche Steigerung für zu überbordend halten – am fabelhaften Eindruck des Abends ändert das nichts.
Zilias zeigt, dass „Parsifal“ sich nicht im Rausch der Linien erschöpft, dass die psychedelische Verführungsabsicht Wagners keineswegs das bestimmende Element der Musik sein muss, wie offenbar ein hartnäckiger, Protest im Publikum hervorrufender Buh-Rufer annimmt. Deutlich wird vielmehr, dass die Musik aus Konturen lebt, dass der Klang ausdifferenziert werden will, dass Einsätze, Farb- und Haltungswechsel nicht nur unmerklich ineinander übergehen, sondern akzentuierenden Zugriff brauchen. Auch der Chor von Lorenzo da Rio verliert sich nicht im Säuseln, lässt im marcato auch die aggressive Note dieser Gesellschaft erkennen. In den Fernchören gibt es schmerzhafte Wackler, das ist aber auch in Düsseldorf nicht anders, wo Gerhard Michalski seine Herren auf satte Sonorität und entschieden drängenden Gleichklang getrimmt hat.
Axel Kober in Düsseldorf, mit der Erfahrung des Bayreuther „Abgrunds“ im Sinn, liest die „Parsifal“-Partitur mischklangverliebter, aber auch mit Lust an langsamem, im ersten Aufzug zerfließend lahmendem Zeitmaß. Die Düsseldorfer Symphoniker zeigen in den Violinen wenig Kontur, bleiben im Finale zu sehr im Hintergrund und ohne Magie. Für die sensualistischen Provokationen der Klingsor-Welt produziert das Orchester nur gedeckte Farben und schalen erotischen Kitzel.
Sänger-Triumphe an beiden Häusern

Düsseldorf: Hans-Peter König (Gurnemanz) und Sarah Ferede (Kundry). (Foto: Andreas Etter)
Gesungen wird an beiden Häusern sehr achtbar, teilweise auf einem Niveau, das man sich für Bayreuth wünschen würde. Der Trumpf in Düsseldorf heißt Hans-Peter König: ein beispielhafter Wagner-Sänger, klangvoll im Timbre, ausgeglichen in der Tonproduktion, wortverständlich und mit musikalischen Nuancen gestaltend. Ein großartig erzählender Gurnemanz. Aber auch Luke Stoker als präsenter Titurel überzeugt auf ganzer Linie. Michael Nagy erscheint im Zentrum der sich kreuzenden Linien der Bühne als blutige Christus-Assoziation und singt entspannt und expressiv – ein markanter Kontrast zum Klingsor von Joachim Goltz, der mit bewusst gehärteten, schneidenden Tönen und konzentriert fokussierend aus dem verstoßenen einstigen Gralsritter die grimmige Enttäuschung und den Willen zur Vergeltung herausstößt.
Daniel Frank, der Düsseldorfer Parsifal, wirkt zunächst recht dünnstimmig und grell, fängt sich im zweiten Aufzug und kann im dritten beweisen, dass er mit Kern und gesichertem Klang aussingen kann. Sarah Ferede wird in die Partie der Kundry noch hineinwachsen: Ihr Auftritt im Reiche Klingsors beginnt imposant, ihren Schmeicheltönen fehlt es nicht an Schmelz. Die letzte Rundung, die Souveränität über die Momente des Extremen, das Vermeiden von Schärfe in der Kraft fordernden Höhe sind noch nicht ausgereift. Auch Irene Roberts, die Kundry in Hannover, ist noch nicht so weit: Lautstärke ist keine Garantie für die Intensität des Ausdrucks, eine Stimme am Limit wirkt eher gefährdet als gefährlich und das Vibrato darf kontrollierter sein.
Der Star in Hannover heißt Michael Kupfer-Radecky – in Bayreuth war er Wotan in der „Walküre“ und Gunther in der „Götterdämmerung“. In der Doppelrolle Amfortas/Klingsor versteht er es, das Gemeinsame der ähnlichen existenziellen Verletzung, aber auch die Spannung zwischen den beiden so unterschiedlichen Charakteren herauszuarbeiten. Sein Bariton ist kraftvoll, aber nicht übermächtig, der Klang konzentriert, ohne verfestigt zu wirken. Kupfer-Radecky legt die Seele der Worte frei, und allenfalls in der einen oder anderen Verzerrung eines Vokals macht sich bemerkbar, wie viel Einsatz und Mühe hinter einer solchen Gesangsleistung steckt.
Daniel Eggert rückt als Titurel nicht in den Vordergrund; er singt klangschön zurückhaltend, Shavleg Armasi ist ein beredter Gurnemanz, der dieser Figur eine sympathische menschliche Note mitgibt – kein Grund, Missfallen zu äußern, wie es am Ende vom Rang herabschallte. Marco Jentzsch entkleidet den Parsifal in Hannover jeder heldischen Attitüde, hat aber nicht die Reserven, um die plötzliche Einsicht nach dem Kuss Kundrys und die daraus folgende Entschlossenheit zu beglaubigen. Zumal der Tenor auch im Lyrischen dünn wirkt, Piani nicht gestützt sind und die ausgemergelte Schärfe des Tons in dramatischen Momenten nur lautes und explosives Stemmen erlaubt. Dennoch bleibt es dabei: Musikalisch hat Hannover wegen der Klasse des Orchesters und einem spannungsvolleren Dirigat die Nase vorn, szenisch muss sich Düsseldorf vor dem Aufwand auf der niedersächsischen Bühne in keinem Augenblick verstecken.
Vorstellungen in Düsseldorf: 1., 15., 21.10.2023; 29.03., 07.04.2024. Info: https://www.operamrhein.de/spielplan/kalender/parsifal/1285/?a=termine
Vorstellungen in Hannover: 3., 8., 15., 22., 31.10. Info: https://staatstheater-hannover.de/de_DE/programm-staatsoper/parsifal.1343152