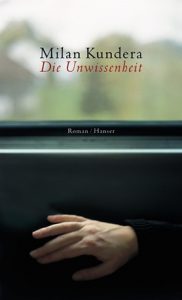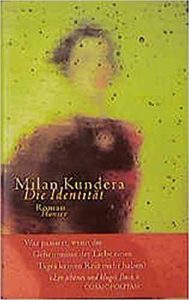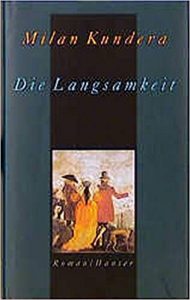Wundersam fröhlich: Milan Kundera feiert „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“
Es schien, als sei Milan Kundera literarisch verstummt, hatte doch der Autor, der 1975 seine tschechische Heimat verließ und seitdem in Paris lebt, viele Jahre keinen Roman mehr veröffentlicht. Doch jetzt, mit 85 Jahren, meldet er sich zurück. Mit einem Roman, der mit melancholischer Heiterkeit und humorvoller Eleganz ein ironisches „Fest der Bedeutungslosigkeit“ zelebriert.
Milan Kundera zählt zu jenen Autoren, die schon deshalb zeitlos allgegenwärtig sind, weil die Titel ihrer Romane – „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ – einen philosophischen Fantasieraum aufschließen und geradezu sprichwörtlich wurden. Und weil sie beim Schreiben immer auch über die Bedingungen und Absichten des Schreibens nachdenken.
Und so ist es auch jetzt wieder, als schaue sich Kundera beim Formulieren zu und habe unendlichen Spaß daran, mit seiner Rolle als Erzähler zu jonglieren. So lässt er einen gewissen Ramon (eine literarische Figur, die seinem Erfinder sehr ähnlich ist) die von Kundera in seinen Werken schon mehrfach variierte existenzielle Philosophie der Negation auf den Punkt bringen: „Die Bedeutungslosigkeit“, sagt Ramon, „ist die Essenz der Existenz. Sie ist überall und immer bei uns. Sie ist sogar dort gegenwärtig, wo niemand sie sehen will: in den Greueln, in den blutigen Kämpfen, im schlimmsten Unglück.“
Die List der Dialektik weiß natürlich, dass – wenn nichts wirklich von Bedeutung ist – auch der Roman, an dem Kundera mit Hilfe von Ramon gerade feilt, nichts bedeutet, nur ein Zeitvertreib ist, ein Spiel, eine Illusion. Dies zu verstehen, macht aber auch frei und fröhlich. Und so wird ihm die Bedeutungslosigkeit zugleich auch zum „Schlüssel zur Weisheit“ und zum „Schlüssel zur guten Laune.“
Ja, Kundera ist wahrhaftig gut gelaunt, lässt Hegel und Stalin, Schopenhauer und Chruschtschow aufmarschieren, um sie zu karikieren und zu unfreiwilligen Zeugen der Bedeutungslosigkeit zu machen. Ob Krieg und Katastrophen, Literatur und Kunst, alles nur trostloser Tand.
Um noch einen letzten Erzähl-Walzer zu tanzen, lässt Kundera einige Herren durch Paris flanieren: Alain beobachtet junge Frauen und sinniert über die Erotik des Bauchnabels. Ramon würde sich gern eine Chagall-Ausstellung anschauen, kapituliert aber vor der langen Museumsschlange. Charles reißt politische Witze und organisiert Cocktailpartys, auf denen Caliban, ein Schauspieler ohne Engagement, als Aushilfskellner jobbt. Schließlich D´Ardelo, der sich eine erfundene Krebserkrankung zulegt und sich über seine eigenen Lügen amüsiert.
Ach ja, ein paar Frauen huschen auch noch kurz durchs Bilder-Gestöber: Eine junge Portugiesin, die, weil sie kein Französisch beherrscht, nur nonverbal kommuniziert. Oder eine schwangere Frau, die beim Versuch, sich zu ertränken, ihren vermeintlichen Lebensretter tötet und nun mit der Schuld weiterleben muss, aber ihrem verpfuschten Leben eine ganz neue Bedeutung geben kann.
Kundera umkreist seine Figuren, begegnet ihnen kurz und entlässt sie dann wieder in das Straßenlabyrinth von Paris, in die Freiheit und zum Fest der Bedeutungslosigkeit.
Milan Kundera: „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“. Roman. Aus dem Französischen von Uli Aumüller. Hanser Verlag, München. 140 Seiten, 16,90 Euro.