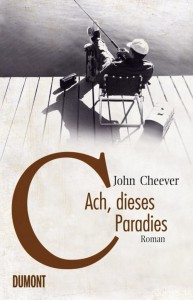Draußen vor der Stadt: Landwehren, Ballspiele und Müllabfuhr im 16. Jahrhundert
Landwehren sind lang gestreckte Erdwälle, die im Mittelalter angelegt wurden, um das Territorium gegen Eindringlinge zu schützen oder um Räuberbanden die schnelle Flucht vor allem mit Fuhrwerken zu vereiteln. Darüber erschien hier vor drei Jahren bereits ein Artikel als „historisches Stichwort“. Jetzt gibt es zu diesem Thema ein sehr informatives neues Buch, dem sich interessante Einzelheiten entnehmen lassen. Das Werk entstand nach einer Fachtagung der Altertumskommission für Westfalen.
In den Aufsätzen der Wissenschaftler kann man viel erfahren über den Aufbau und die Funktion der Wehren, auch die manchmal dazu gehörenden Türme werden vorgestellt, und man kann an alten Karten und Fotos erkennen, wo solche Landwehren noch heute in der Natur sichtbar sind. Außerdem wird vorgestellt, wie und in welcher Häufigkeit sich das Wort Landwehr in Flur- und Familiennamen erhalten hat.
Solche Bollwerke gab es in Westfalen natürlich nicht nur zwischen den Landesherrschaften, sondern auch zwischen dem bäuerlichen Land und den Städten. Bernd Thier, einer der Autoren, widmet sich ausführlich dem Beispiel Münster. Vor allem über die Nutzung des Geländes außerhalb der Stadtmauer zitiert er interessante Quellen.
Schon für die Mitte des 16. Jahrhunderts sind Flächen für Ballspiele und Sommerhütten der betuchten Bürger belegt, Teiche für die Fischzucht entstanden, und vor allem wurde der Müll der Stadtbürger vor den Mauern entsorgt. Schon im 16. Jahrhundert ließ der Magistrat in Münster den Abfall durch einen öffentlichen Wagen abfahren, um damit die Äcker außerhalb zu düngen. Die Stadtführung stellte dazu ein Pferd und einen „Dreckkarren“ zur Verfügung. Verstorbene Christen wurden in der Stadt rund um die Kirchen und den Dom beigesetzt. Außerhalb der Mauern lag hingegen der jüdische Friedhof, wie im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit üblich.
Dieses sind nur ein paar Details eines Sammelbandes, der für Freunde der Landeskunde und der westfälischen Geschichte weit mehr zu bieten hat und der gar nicht so „dröge“ zu lesen ist, wie man es sonst den Westfalen zu sein unterstellt.
Cornelia Kneppe (Hrsg.): „Landwehren. Zu Funktion, Erscheinungsbild und Verbreitung spätmittelalterlicher Wehranlagen“. Aschendorff Verlag, 350 Seiten, 39 €.