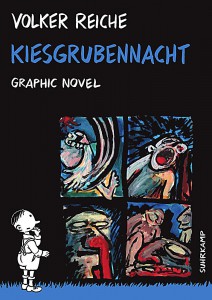Pionierin mit der Kamera: Frauenfilmfestival erinnert an die Dortmunderin Elisabeth Wilms
Als „filmende Bäckersfrau“ hat sich Elisabeth Wilms (1905-1981) lange Zeit selbst verstanden. Oft und penetrant wurde diese Formel später in journalistischen Titelzeilen aufgegriffen, bis sie vollends zum Klischee geronnen war.
Jetzt werden ausgewählte Arbeiten von Elisabeth Wilms in einem regionalen Schwerpunkt des Internationalen Frauenfilmfestivals in Dortmund gezeigt. In diesem Kontext ist es natürlich erst recht nicht ratsam, sie als Ehefrau vorzustellen, die lediglich ihrem Hobby gefrönt habe. Da klingt es doch weitaus besser, dass der Gatte Erich, als er nach Jahrzehnten der Plackerei 1964 die Bäckerei verpachtet hatte, von ihr fortan als Chauffeur und Stativträger beschäftigt wurde…
1932 hatte die gebürtige Münsterländerin just nach Dortmund eingeheiratet und Tag für Tag im Bäckereiladen des damals noch dörflich anmutenden Ortsteils Asseln gestanden, nebenher ihre Filmleidenschaft entdeckt und nach und nach ihr spürbar vorhandenes Talent staunenswert entwickelt. Unschätzbar wertvolles Zeitzeugnis: 1943 filmte sie das noch unzerstörte Alt-Dortmund. Welch ein Jammer, dass dies alles längst dahin ist.
Schnitt am Wohnzimmertisch
Elisabeth Wilms hatte ein Gespür fürs Wesentliche, das sie mit gekonnter Kameraführung umzusetzen verstand. Den Schnitt besorgte sie selbst am heimischen Wohnzimmertisch. Und als sie sich eine bessere Kamera leisten konnte, war das alsbald auch an der Qualität der Filme abzulesen.
Ihre ersten Streifen wie „Münsterland – Heimatland“ oder „Der Weihnachtsbäcker“ wurden 1944 von der Filmprüfstelle ausgezeichnet. Sie fügten sich – ob gewollt oder nicht – ins kritiklose Heimatbild der NS-Zeit. Was Betrachter_innen (so die Schreibregelung im Festivalheft) nicht ohne weiteres wissen können: Der Bäckermeister im Weihnachts-Film war nicht etwa Elisabeth Wilms’ Ehemann Erich. Der war damals als Soldat im Einsatz. Deshalb übernahm ein Kriegsgefangener seine Rolle. Und der Lehrling, der in dem anheimelnden Streifen vorkommt, ist kurz darauf gegen Ende des Krieges gefallen. Sprich: Der verborgene Hintergrund des Films ist ungleich bedeutsamer als das, was auf der Leinwand erscheint.
Trotz strenger Verbote machte Frau Wilms heimlich Aufnahmen während der Bombenangriffe auf Dortmund und Münster. Es war dies aber auch schon das Höchstmaß an Ungehorsam, das sie sich erlaubte.
Blanke Not in der Trümmerzeit
Weithin bekannt wurde Elisabeth Wilms mit Filmen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, die 1980/81 um ihre nachträglich aufgesprochenen Kommentare ergänzt wurden. „Alltag nach dem Krieg“ (1948) berichtet in bewegenden, höchst einprägsamen Bildern vom Elend der Dortmunder Bevölkerung in der Trümmerlandschaft.

Szene aus dem Wilms-Film „Alltag nach dem Krieg“ (1948): Armenspeisung für Kinder. (© Elisabeth Wilms/KG Asseln)
Mitten in den Ruinen hausten die Menschen unter heute unvorstellbar erbärmlichen, oft lebensgefährlichen Bedingungen. Es wird einem weh zumute, wenn man in all die ausgemergelten Gesichter schaut. Mit Szenen von Schwarzmarkt, Hamsterfahrt und notgedrungenem Kohlenklau erweist sich der Film als erstrangiges zeitgeschichtliches Dokument. Manch eine Einstellung wird man nicht so schnell vergessen – und das zeugt auch von der besonderen Begabung der Elisabeth Wilms, die mit diesem Film zu Spenden aufrufen wollte.
Wie die Westfalenhalle entstand
Mit teils riskanten Drehs hat Elisabeth Wilms 1951/52 den Bau der neuen Dortmunder Westfalenhalle filmisch begleitet. Es lässt sich so wenden, dass sie sich in dieser Männerwelt der Bauleute behauptet hat. Jedenfalls ist es ein interessanter Film, der auch als Lob der Arbeit und der vielen beteiligten Gewerke durchgeht.
Bei der Festival-Vorführung dürfte es freilich bestenfalls für nachsichtiges Lächeln sorgen, dass beim Eröffnungsprogramm der Halle „das schwache Geschlecht“ (O-Ton von damals) Gymnastik vorführen durfte. Für Unkundige sei’s gesagt: Damit waren Frauen gemeint.
Wirtschaftswunderbare Waschmaschine
Später drehte Elisabeth Wilms vielfach Auftragsarbeiten und Werbefilme – beispielsweise für eine Constructa-Waschmaschine, die der geplagten Hausfrau das Leben erleichtern sollte. Bevor der Ehemann sich gnädig zum Kauf herbeiließ, waren – mit gereimten Sprüchlein – rund 9 Minuten (!) einer zeittypischen Familiengeschichte zu absolvieren, in denen natürlich alles für die Waschmaschine sprach, die übrigens auch das Honorar für diesen putzigen Werbefilm darstellte. Den Chefs des unentwegt ins Bild gerückten örtlichen Stromversorgers VEW dürfte das Filmchen gleichfalls gefallen haben.
Fern von aller Renitenz
Elisabeth Wilms und ihre Filme können heute weder politisch noch feministisch vereinnahmt werden, dazu ist das in diesen Schöpfungen waltende Bewusstsein denn doch zu harmlos und kleinbürgerlich. Utopien oder Befreiungs-Sehnsüchte sind diesen Werken nicht eigen, von Rebellion ganz zu schweigen.
Gleichwohl war da eine begabte Pionierin am Werk, die zwar nicht anderen den Weg ebnete, aber recht konsequent ihren eigenen Weg beschritten hat; wobei sie es vergleichsweise leicht hatte: Ihr Film über eine Italienreise aus den 1950er Jahren zeigt gediegenen Wohlstand mit Opel Kapitän und imposantem Wohnananhänger. Daheim besorgte ihre Schwägerin den Haushalt. Auf solchen Komfort konnte damals wahrlich nicht jede Frau zurückgreifen.
Vermessung der „Komfortzonen“
Apropos Komfort. Das stilistisch und thematisch sehr weit gefächerte Dortmunder Frauenfilmfestival widmet sich diesmal dem äußerst dehnbaren Begriff „Komfort“ und schickt sich an, gleichsam rund um den Erdball in allerlei Formen „Komfortzonen“ (auch so ein Modewort) auszuloten bzw. deren Verlust zu ermessen. Der Ruhrgebiets-Schwerpunkt firmiert übrigens unter dem Leitbegriff „Arbeit“, der etwas bemüht mit „Komfort“ kurzgeschlossen wird: Ohne Arbeit gibt es meist keinen Komfort. Wohl wahr…
An diversen Orten der Stadt (Festivalzentrum im Dortmunder „U“, weitere Spielstätten im domicil, Schauburg und Cinestar) sind in den nächsten Tagen laut Broschüre „rund 40 Programme von der Quarkgebäck-Werbung bis zum iranischen Vampirfilm“ zu erleben. Selbstverständlich stehen vielfältige Bilder des Frauenlebens im Mittelpunkt – in aller Welt und zu verschiedenen Zeiten.
Der historische Reigen beginnt im frühen 20. Jahrhundert – mit 1917/18 gedrehten Stummfilmen von Rosa Porten, die seit der Entstehungszeit in Deutschland nicht mehr zu sehen waren. Da darf man von wohl einer kleinen Sensation sprechen.
Nähere Informationen zum Festival-Programm (14. bis 19. April):
www.frauenfilmfestival.eu