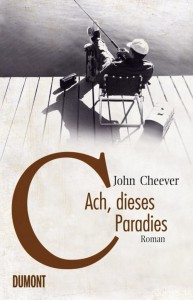Meine weise Oma mahnte gern: „Kind, geh nicht am Samstagnachmittag ins Kino, wenn es regnet.“ Sie hatte wie immer Recht.
Mein Leib- und Magenkino, das Metropolis in Köln, war krachend voll, obwohl der Film als OF angekündigt war. Solchen Informationen ist nie zu trauen: es war OmU. Es wird allerdings im Film ziemlich wenig gesprochen, und das bisschen Text wurde nur blitzartig kurz eingeblendet. So gesehen…
Der Film also, von dem ich nicht mal Trailer gesehen, von dem ich generell nur kurz eingestöhnte: „Hach, schön…“ vernommen hatte, begann dramatisch. Weniger die Handlung (erst mal keine für ne gefühlte Stunde) als die Bilder. Bilder in überwältigenden Farben und Beweglichkeiten. Überwältigend! GEO und National Geographics all rolled in one mit orchestraler Musik dazu. Die Evolution im Zeitraffer. Prächtige Szenen mit Vogelschwärmen, die balletös ihre Choreographien in den Himmel tanzen.
Es ist eine solche Wonne, den Meeren und Urwäldern, den Vulkanen und Gletschern, Meteoriten und der eruptierenden Sonne beim Evolutionieren zuzuschauen, dass man vorübergehend ganz vergisst, dass doch nun bald mal Brad Pitt, Jessica Chastain und Sean Penn ins Bild treten sollten. Das tun sie dann aber auch. Die Menschenstory des Films beginnt. Bezeichnend ist, dass es kleine Episoden sind, die nicht sofort in einem Zusammenhang stehen. So erkennen wir zwar an den Reaktionen der Eltern, Mr. & Mrs. O’Brian (Pitt, Chastain), dass etwas Schreckliches passiert sein muss, aber wir sehen nicht, wie, wir ahnen das Was.
Wir sehen in Flash-backs die Geburten der drei Söhne, wie sie in den Fünfzigern in der Kleinstadt Waco in Texas aufwachsen, ein ganz normales Leben führen. In der ruhigen Straße spielen, Unsinn machen, mit Nachbarskindern Streiche aushecken. Wir fühlen ihre vertrauensvolle Zuneigung zur Mutter, einer elfenhaften jungen Frau, die ihre Kinder liebt, ihnen Raum gibt, ihre starke innere Bindung zu ihnen, ganz besonders zu Jack. Ihre Liebe soll ihnen die Kraft geben, die unkontrollierten Ausbrüchen des Vaters durchzustehen. Der Vater ist ein strenger Mann. Er ist emotional verschüttet. Er bedrängt die Kinder, misshandelt sie seelisch. Besonders der älteste Sohn, Jack, leidet unter ihm, versucht sich mit ihm auseinander zu setzen. Mr. O’Brian wäre gerne ein guter, ein perfekter Vater, er möchte gern eine funktionierende, eine liebevolle Beziehung zu seiner Frau und den Söhnen, aber er kann aus seinem Korsett nicht raus. Er wäre gern ein Künstler geworden, ein Pianist, spielt aber nur Orgel in der Kirche und zu Hause am Klavier.
Es ist ein Leben, das Millionen von Amerikanern so gelebt haben, so auch in Zukunft leben werden.
Die kurzen Episoden sind immer wieder von den dramatisch schönen Bildern der Schnee- und Sandwüsten und Gebirge und Tetonen, der Saurier und Meeresbewohner umrahmt. Eine ruhige Stimme legt sich über die Szenen mit der Familie.
Trotz der Wucht der Bilder, trotz der tyrannischen Vaterfigur, trotz der elfengleichen Mutter ist es ein harmonischer Film.
Jessica Chastain ist… lieblich und herb zugleich. Worte, die ich eher bei der Beschreibung von Wein anwende. Sie ist Harmonie in einen schönen kleinen Körper gegossen. Es gibt eine Szene, in der sie auf dem räudigen Rasen vorm Haus steht und sich mit dem Gartenschlauch die Füße – schöne Füße – abwäscht. Ich rieche den warmen Sommerabend, spüre die flirrende Luft, höre die Abendgeräusche – und mittendrin Jessica Chastain, Mrs. O’Brian, die Waldfee mit dem plätschernden Wasser. Sinnlich.
Brad Pitt gab diesmal nicht den knackigen Helden. Die ersten Bilder zeigen ihn von hinten seitlich, was ihn bräsig und ein bisschen schweinebackig aussehen lässt. Später tritt er als korrekt gekleideter, disziplinierter Büroangestellter auf. Sean Penn – der “dignified” altert – ist der erwachsene Sohn Jack. Sean Penn ist… nun, Sean Penn, den ich sehr schätze.
Der Regisseur, Terrence (Terry) Malick hat erst vier Filme gemacht. Nun kenne ich drei davon. “A thin red Line” ist einer davon. An seinen Ersten, „Badlands“ erinnere ich noch sehr gut. Da spielte übrigens Sissy Spacek mit, damals grade 24, sechs Jahre jünger als Chastain in „Tree of Life“. Die beiden sind sich frappierend ähnlich. Ich bin nicht überrascht über die Besetzung in Malicks nächstem – bisher titellosem – Film, der 2012 rauskommen wird. Hier spielt Chastain wieder mit. Zusammen mit Javier Bardem. Vorsichtige Vorfreude ist angesagt.
Bis dahin schaut Euch „Tree of Life“ an, lasst es auf Euch wirken, lasst Euch darauf ein. Trotz einiger Abstriche, auf die ich bewusst nicht eingehe, ist das ein sehenswerter Film.
Von mir vier Sterne auf meiner eigenen Richterscala von Fünf.