Mit Geschmack und Sentiment: Klarinettenmusik von Iwan Müller
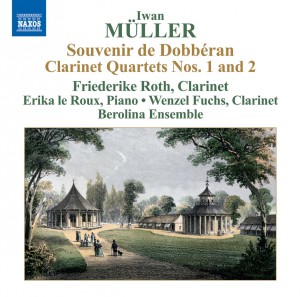 Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.
Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.
Doch Müller gibt nicht auf. Seine Konzertreisen sind gleichzeitig Werbefeldzüge: Mit selbst geschriebener, virtuoser Musik offeriert er die Möglichkeiten seiner chromatischen Klarinette, kann in Kassel, Berlin, Wien und London überzeugen. 1825 veröffentlicht er eine Klarinettenschule; mit Georg Wilhelm Heckel, einem begabten Instrumentenbauer aus Wiesbaden, baut er eine Serie von Musterklarinetten. Die „Müllerklarinette“ ist die Urmutter der heutigen „deutschen“ Klarinette.
Den Komponisten – und Virtuosen – Iwan Müller stellt eine kurzweilig anzuhörende CD der Firma Naxos vor: Die Klarinettisten Friederike Roth und Wenzel Fuchs spielen, begleitet von der Pianistin Erika Le Roux oder im Verein mit dem Berolina Ensemble Kammermusik des erfinderischen Weber-Zeitgenossen. Im gleichen Jahr 1786 geboren, hört man bei Müller den empfindsam-kantablen Tonfall des Romantikers, mehr noch freilich die Einflüsse der Belcanto-Oper des beginnenden 19. Jahrhunderts. Müller war Solo-Klarinettist unter anderem an der Pariser Oper, bevor er seinen Lebensabend am Hof von Schaumburg-Lippe in Bückeburg, an der Ostgrenze zu Westfalen, verbrachte. Dort starb er 1854.
Müllers Musik gehört zu jener später verpönten Art von Virtuosenmusik, die – zu schwer für den Dilettanten – vor allem der anspruchsvollen Unterhaltung und der Präsentation der spieltechnischen Raffinesse eines Solisten diente. Einen Mozart oder gar Beethoven wird man in seinen beiden Klarinettenquartetten aus dem Jahr 1820 nicht entdecken – aber das macht auch nichts: Müller entwickelt seine Melodien mit einem aparten Charme, der auch heute noch mit Vergnügen zu hören ist.
Ein Werk wie die „Scène romantique“ erinnert in seinem ersten Satz, „Adagio con espressione“, an Leidens- und Traumszenen aus der Oper; eine Polonaise wie „Le château de Madrid“ gibt der Klarinette reichlich Gelegenheit, wie eine Primadonna aufzutreten. Verzierungen, Rouladen, Sprünge, chromatische Eintrübungen, weite Legatobögen: Der stets mit leuchtend-brillantem Ton spielenden Klarinettistin Friederike Roth wird nichts geschenkt.
Auch die Pianistin Erika le Roux pflegt die theatralische Geste, ohne sich allzu sehr vom Sentiment zu distanzieren oder es überbetont zu denunzieren. Solche Musik will mit Geschmack und Sensibilität gespielt sein – und die Musiker, einschließlich der Streicher des Berolina Ensembles (David Gorol, Andreas Mehne, Martin Smith), pflegen diese Tugenden.
Fast möchte man meinen, im „Souvenir de Dobbéran“ für zwei Klarinetten und Klavier höre man das rhythmische Stampfen der Dampf-Schmalspurbahn, die heute noch Bad Doberan mit der „großen Welt“ verbindet – aber von diesem modernen Verkehrsmittel hatte Müller noch keine Ahnung. Eine CD, die an einem dämmrigen Nachmittag oder zu einer Tasse Tee mit Vergnügen hören lässt – und die ein Fenster in eine musikalische Kultur öffnet, die uns heute nur noch in Bruchstücken bekannt ist.
Iwan Müller: Souvenir der Dobbéran. Clarinet Quartets Nos. 1 and 2, Naxos 8.572885
