Ziemlich lange her, aber immer noch bedeutsam: Beklemmender Vorfall bei einer Lesung von Edgar Hilsenrath

Der Schriftsteller Edgar Hilsenrath am 23. März 2010 im Salon du live, Paris. (Foto: Georges Seguin / Wikimedia Commons / Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Ein Gastbeitrag von Heinrich Peuckmann:
In dem kleinen Städtchen Kamen, in dem ich wohne, gab es in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine beachtenswerte Literaturreihe: „Die literarische Teestunde“ hieß sie, in der bedeutende Autoren ihre neuen Romane vorstellten.
Es war trotz des kostenlos servierten Tees ein mühsames Unterfangen, denn der Zuspruch in der Bergarbeiterstadt blieb dürftig, wovon sich der damalige Volkshochschulleiter und Verantwortliche der Reihe aber nicht entmutigen ließ.
Als Uwe Johnson vor einem Dutzend Zuhörer las
Uwe Johnson las hier aus dem zweiten Band seiner „Jahrestage“ vor einem Dutzend Zuhörer. Noch heute spüre ich meine damalige Beschämung. Gelegentlich versuche ich, mich mit dieser Erfahrung zu trösten, wenn ich es bei einer eigenen Lesung im Ruhrgebiet auch nur auf ein Dutzend Zuhörer gebracht habe. Dem Uwe Johnson ist es nicht besser ergangen, denke ich, aber damit endet dann auch jeglicher Vergleich. Anmaßung liegt mir fern.
Anfang der achtziger Jahre las (der am 30. Dezember 2018 verstorbene) Edgar Hilsenrath in Kamen aus seinem umstrittenen Roman „Der Nazi & der Friseur“. Es war eine mutige Entscheidung, ihn einzuladen, denn dieser Schelmenroman wurde damals heftig kritisiert. Er war sowieso erst sechs Jahre nach seinem Erscheinen in den USA in Deutschland gedruckt worden, und das auch nur in dem kleinen Kölner Braun-Verlag.
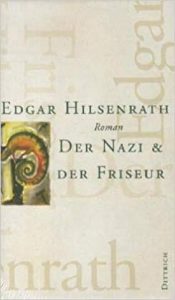
Hilsenraths Roman „Der Nazi & der Friseur“ – nicht in der Originalausgabe des Braun-Verlages, sondern in der Werkausgabe bei Dittrich. (© Dittrich Verlag)
Hilsenrath, aus einer jüdischen Familie stammend, kritisierte darin Juden, was in Zeiten des Philosemitismus als grober Verstoß gegen die politische Sprachregelung galt. Außerdem machte er noch einen Massenmörder der Nazizeit zur Hauptfigur. Dass er ihn zum Helden machte, wäre eine unpassende Bezeichnung, aber Max Schulz, dieser Mörder, erzählt mit Witz seine Geschichte, so dass er nicht durchgängig abstoßend wirkt.
Auf einmal tauchten die Leute mit Schäferhund auf
Die Kamener Lesung begann normal, das heißt, es tauchten die üblichen zehn Verdächtigen als Zuhörer auf. Hilsenrath ließ sich dadurch nicht beirren und begann, die erste Passage aus seinem Roman vorzulesen.
Dann aber passierte etwas, das alle überraschte. Die Tür ging auf und ein Dutzend Leute, mehr Männer als Frauen, alle zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt, erschien und nahm auf den freien Stühlen Platz. Einer von ihnen hatte tatsächlich einen Schäferhund an der Leine. Eine bizarre Szene, die irgendwie, wenn ich im Rückblick darüber nachdenke, zu den deftigsten Passagen in Hilsenraths Roman passte. Satire im Buch, Realsatire, allerdings gefährliche, im Saal, denn von Anfang an war klar, dass hier keine literarisch interessierten Bürger den Raum betreten hatten, sondern Neonazis.
Früherer Bauernhof als Schulungszentrum der Neonazis
In Kamen gab es damals auf einem Bauernhof ein Schulungszentrum der Neonazis. Hintergrund war der frühe Tod des Bauern, seine Frau heiratete noch einmal und dieser zweite Ehemann war ein Neonazi. Er nutzte die Chance und baute den Bauernhof, der ihm gar nicht gehörte, zu einem Schulungszentrum aus. Regelmäßig zum Wochenende kamen Neonazis aus ganz Deutschland angereist, teilweise in Bussen, und bekamen ihre Dröhnung in Sachen Rassismus, die sie Bildung nannten, begleitet von Erklärungen, dass Hitler und die Nazizeit nicht so schlimm gewesen wären. Regelmäßig war dieser Bauernhof Zielort unserer Demonstrationen, regelmäßig musste die Polizei anrücken, um Zusammenstöße zu verhindern.
Die Kamener Stadtverwaltung tat so gut wie nichts, es marschierte auch so gut wie nie einer von den Stadtoberen bei unseren Aktionen mit uns. Die NPD sei keine verbotene Partei, wurde uns erklärt, und was ihre Mitglieder auf ihrem Privatgelände veranstalteten, entziehe sich der Entscheidungsgewalt der Stadt. Wer aber in seinem Gebäude Schulungen durchführt, hielten wir dagegen, muss Hygienebestimmungen einhalten, muss genügend Duschen und Toiletten vorweisen. Wir wiesen die Stadtverwaltung mehrfach darauf hin, dass dies ein Hebel sein könnte, das Unwesen zu unterbinden, aber es wurden keine Kontrollen durchgeführt.
Ein NS-Verbrecher, der sich später als verfolgter Jude ausgab
Das Schulungszentrum errang mit der Zeit traurige Berühmtheit. Max von der Grün, der ganz in der Nähe wohnte, hat es eingebaut in seinen Roman „Flächenbrand“. In seiner besorgten Schilderung vom Aufstieg der Neonazis gibt es deutliche Parallelen zu der Einrichtung in Kamen.
Beseitigt wurde dieser Schandfleck erst, als die Frau des Bauern starb und ihre Söhne den sonderbaren und offenbar verhassten Stiefvater sofort an die frische Luft setzten, so dass ich heute bei meinen Erzählungen den Namen des Hofes verschweige. Die Söhne können ja nichts dazu, dass er so übel missbraucht wurde, und als sie selber entscheiden konnten, haben sie sofort das Richtige getan.
Zur Zeit von Hilsenraths Lesung war es aber noch nicht so weit. Nach einem Moment der Irritation und nachdem der Schäferhund neben einem Stuhl Platz genommen hatte, setzte Hilsenrath seine Lesung fort. Sein Erzähler Max Schulz schilderte darin, wie er sich vom Massenmörder im KZ zum Juden wandelte und damit vorgab, nicht Täter, sondern Opfer gewesen zu sein. Die Romanfigur hat übrigens ein reales Vorbild gehabt, erfuhr ich später bei einer Recherche. Es hat tatsächlich einen Naziverbrecher gegeben, der sich nach dem Krieg als verfolgter Jude ausgab.
Eklat nach Anspielung auf Hitlers mögliche Impotenz
Trotzdem, die Konzentration unter uns Zuhörern war gestört. Immer wieder schielten wir hinüber zu den Neonazis. Würden sie dazwischenrufen, würden sie womöglich eine Schlägerei provozieren? Aber nein, sie hielten sich anfangs zurück. Heftige Zwischenrufe, vor allem von den Frauen, gab es erst, als Hilsenrath vorlas, dass Hitler impotent gewesen sein müsse. In Sachen Männlichkeit hätte er nicht viel zustande gekriegt. Die empörten Rufe vor allem der Frauen sind mir bis heute im Gedächtnis: „Also, das ist doch … unerhört ist das.“ Eine lächerliche Szene, die da vor uns ablief, die reale Situation näherte sich immer mehr der fiktiven im Schelmenroman an. Ich konnte, wie andere auch, ein Lachen nicht unterdrücken.
Zwischenfragen wurden anschließend gestellt. Woher Hilsenrath wisse, dass in den KZs gemordet wurde. Hilsenrath, antwortete, er habe selbst in einem gesessen und habe nur knapp überlebt. Dann würde ihn eben sein Gedächtnis täuschen, wurde gerufen. Der Ton wurde rauer, schließlich aggressiv, und der VHS-Leiter verließ für einen Moment den Raum. Ich ahnte den Grund, er rief die Polizei.
Dass Hitler als Vegetarier persönlich ein schwächlicher Typ (oder so ähnlich) gewesen sei, wie Hilsenraths Erzähler weiter behauptete, empörte die Neonazis erneut. Nein, der Führer und schwächlich, das ging nun gar nicht. Während all der Unruhe war es übrigens der Schäferhund, der am ruhigsten blieb. Romane und was darin behauptet wurde, interessierten ihn nicht, er döste, den Kopf auf seinen Vorderläufen, seelenruhig weiter.
Der Autor wurde bedrängt – doch es war wohl keine „Nötigung“
Nach der Lesung, und das wurde später wichtig, wurde Hilsenrath bedrängt. Die Neonazis wollten ihm die Meinung sagen, und zwar heftig. Sie wollten ihre Abscheu über dieses angebliche Machwerk ausdrücken und redeten lautstark auf ihn ein. Hilsenrath wich immer weiter in eine Ecke des Raumes zurück, bis es ihm schließlich gelang, die Meute loszuwerden und das VHS-Haus zu verlassen. Wie weit die angerückte Polizei dabei eine Rolle spielte, habe ich nicht sehen können.
Ich schrieb einen Bericht für die Lokalpresse über diese unglaubliche Lesung, viel länger als verabredet, andere Medien reagierten, ich glaube, die Nachricht lief auch im Fernsehen. Kurz darauf bekam ich Post von der Staatsanwaltschaft Dortmund. Man wollte mich zu der Anzeige befragen, ob Hilsenrath genötigt worden war. Ich schilderte sie Situation so genau wie möglich, aber Nötigung, nein, das war es im engeren Sinne nicht gewesen. Bedrängen, Beschimpfen, das ja, aber Nötigung eher nicht. Am Ende erklärte mir der Staatsanwalt, dass sich meine Aussage mit jenen der anderen Befragten decke. Die Anzeige wurde also fallengelassen. Ob diese Situation heute auch noch so beurteilt würde? Ich weiß es nicht.
…und Literatur hat doch ihre Wirkungen
Was blieb von diesem Auftritt in der „Literarischen Teestunde“? Man hatte Hilsenrath von der Literaturkritik in die Nähe des Antisemitismus gerückt, einen Naziverbrecher als Erzähler einzusetzen, empfand man als Verharmlosung der Verbrechen in der Hitlerzeit. Ich glaube, der Großkritiker Fritz J. Raddatz, dessen Urteile mir selten gefallen haben, hat in einer Rezension auch in diese Richtung argumentiert.
Die Neonazis in Kamen wussten es besser. Den Roman haben sie als einen Angriff auf ihr faschistisches und rassistisches Weltbild begriffen. Alle satirischen Passagen, besonders jene mit der Impotenz, haben sie wörtlich genommen. Ironie konnten sie nicht erkennen. Mit Ausnahme der Schäferhundes vielleicht. Aber den konnte ich nicht mehr befragen.
Und noch ein Eindruck blieb zurück. Literatur hat Wirkung, habe ich gemerkt, wenn auch nicht immer jene, die man erwarten konnte.

