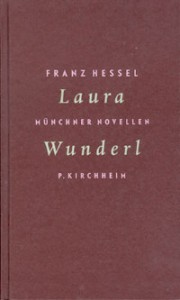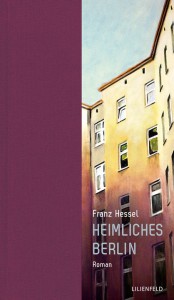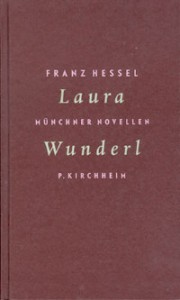Der Lilienfeld Verlag hat in seiner schön gestalteten Reihe der „Lilienfeldiana“ einen Roman Franz Hessels neu herausgebracht.
Laut Walter Benjamin ist Franz Hessel der Mann, der die Kunst des Flanierens von Paris nach Deutschland importierte. Den Flaneur beschreibt er als einen Gegentypen des Zielstrebigen. „Das Absichtliche war nie meine starke Seite“, sagt Clemens Kestner in Hessels Roman „Heimliches Berlin“.
Aus dem Altphilologen, der sich am liebsten in seiner Studierstube verschanzt, spricht die Stimme des Autors, etwa wenn er seinem jüngeren Freund, dem gutaussehenden Wendelin vom Domrau, seine Lebensweise vermitteln möchte. „Ich habe es wohl nie begriffen, dass zum Lieben Besitzen gehört. Da müsste man sich ja das geliebte Wesen aneignen und also enteignen, und was man mit sich vereint, das ändert man. Ich aber möchte alles erhalten, wie es mir erst erschien“, sagt Clemens, nicht ahnend – oder vielleicht doch? – dass Wendelin gerade ein Liebesabenteuer mit seiner, Clemens‘, Frau Karola beginnt.
Während Wendelin ihm eröffnen will, dass er und Karola eine spontane Reise nach Italien beschlossen haben, lässt Clemens seinen Freund zunächst nicht zu Wort kommen: „Also allein. Das ist auch das Beste. Dann ist kein Mittler und Mehrwisser, kein Borger und kein Schenker zwischen dir und den Dingen.“ Und weiter: „Gottlob, dass du nicht mit einer Dame fährst, einer Seelsorgerin und Seelsaugerin, die dich so lange mit ihrer unersättlichen Gegenwart bedrängt, bis du jede Hügelwelle, jeden Fensterbogen, Säulenwuchs und Goldmosaikdämmer auf ihre entsprechenden Reize beziehst.“
Als Wendelin die Fehleinschätzung seines Freundes zaghaft durch ein Geständnis zu korrigieren versucht, ist Clemens‘ Eloquenz nicht zu stoppen: „Kann sie dir schon vormachen, was du fühlst? Sollen dir Frauen Ziele setzen, du ziellos Lebendiges, sollen sie dich auf Kontur verengen, du räumliche Gestalt?“
Der nicht alltägliche Ton im Gespräch mit dem Freund ist nur eine von vielen Stimmen, die Hessels Prosa Seite für Seite zum Lesegenuss macht.
Die Romanfigur Clemens Kestner wird seine Ehefrau nicht mit dem Freund teilen. Ihr Autor dagegen lebte über längere Zeit mit seiner Frau Helen Grund und seinem besten Freund Henri-Pierre Roché eine Ménage-à-trois – für Roché ein Romanstoff, den François Truffaut 1962 mit dem Film „Jules et Jim“ auf die Kinoleinwand brachte. Franz Hessel ist dabei in der Figur des Jules verkörpert.
Wer aus dem 1927 erschienenen Roman „Heimliches Berlin“ einen in die Jahre gekommenen Mann mit schwindender Libido herauszuhören meint, wird durch einen Blick auf Hessels Frühwerk daran erinnert, dass eine Nonchalance in Liebesdingen dort bereits angelegt ist.
„Als ich ein junger Student im ersten Semester war, sagten die anderen, die schon länger in München lebten, immer, ich müsste den Mädchen nachgehen: das gehörte sich nun einmal.“ So beginnt die erste von vier Novellen aus dem 1908 veröffentlichten Band „Laura Wunderl“, den der Verleger Peter Kirchheim in einer liebevollen Ausgabe neu aufgelegt hat.
In einer aufschlussreichen Szene befinden sich zwei Männer und eine Frau in einer Wohnung, kostümieren sich, tanzen. Nina will immerzu mit Fritz, dem Ich-Erzähler, weitertanzen, der sie, als sie schließlich schwer in seinen Armen liegt, zum Diwan trägt. „Wie ich sie hinlegte, kam Wedel herein, in einem indischen Schlafrock von großer Pracht. (…) Ich trat beiseite, als er sich Nina näherte; sie lächelte müde. Plötzlich hatte er sie emporgehoben, sie hing über seine Schulter (…). Seine Augen brannten wie Wolfsaugen im dunklen Walde und er trug seine Beute ins Nebenzimmer – Ich blätterte in dem zärtlich weichen Papier eines japanischen Bilderbuches und blickte erst auf, als die beiden wieder hereintraten. Ich merkte ihnen einige Verlegenheit an und redete brav von japanischer Kunst.“
Wenn Nina ihm später vorwirft, nicht um sie gekämpft zu haben, rechtfertigt er sich mit dem schönen Bild, das Nina und Wedel im Moment des „Beuteraubs“ abgaben. „Ach, Fritz“, sagt sie, „du kannst eben nicht lieben. Du hast nie ein Mädchen lieb gehabt und wirst nie ein Mädchen lieb haben.“
Hessels Charaktere sind Beobachter, ziellose Flaneure wie ihr Autor. Aber die Bücher bieten weit mehr als eine mit dem Charme der Décadence vorgetragene Antriebslosigkeit. Der Roman „Heimliches Berlin“ und der in München spielende Novellenband „Laura Wunderl“ führen den Leser durch das Tages- und Nachtleben der beiden Großstädte und in die unterschiedlichsten Gesellschaftskreise. Zeitweise in einer Wohngemeinschaft mit Franziska Gräfin zu Reventlow, der „Königin von Schwabing“ lebend, kannte sich Hessel ebenso in der Münchner Bohème aus, wie er bald darauf in Paris mit den Literaten und Künstlern des Café du Dôme verkehrte; doch sein ständiger Bezugspunkt blieb Berlin. Seine Stadtspaziergänge eröffnen stadtgeographische Einsichten und liefern anschauliche Momentaufnahmen. So wird bei den nächtlichen Amüsements in „Heimliches Berlin“ beispielsweise ein Dichter in einer Matrosenbluse porträtiert, in dem unschwer Joachim Ringelnatz zu erkennen ist.
Aus der Zeit gefallen erschien Hessels Sprache bereits bei der Erstveröffentlichung seiner Werke. Seine Protagonisten wünschen sich ein kontemplatives Leben, abseits der modernen Hast – wenn etwa Clemens Kestner, der gerade vom Deck eines anhaltenden Autobusses die Wendeltreppe heruntergestiegen ist, zu Wendelin meint: „Unser Dasein bekommt etwas Vulkanisches durch all das beständig explodierende Benzin, das uns vorwärtsrollt.“
Als Literaturtheorie gedeutet, steht die postulierte Absichtslosigkeit des Flaneurs in einem Kontrast zur engagierten Literatur der Zwanzigerjahre, in einem Kontrast aber auch zu den Manifesten und der erbittert ausgefochtenen Gruppendynamik der Surrealisten, an deren traumgelenkte Stadtwanderungen Hessels einzigartige Prosa vielleicht noch am ehesten erinnert.
Hessel, dessen finanzielle Sorglosigkeit spätestens nach der Wirtschaftskrise endete, übersetzte Casanova, Stendhal, Balzac, Jules Romains und gemeinsam mit Walter Benjamin erstmals Marcel Proust ins Deutsche. Während Proust dem Vergangenen nachspürte, um es zu vergegenwärtigen, lässt sich Hessels Prosa – worauf Manfred Flügge in seinem kenntnisreichen Nachwort zu „Heimliches Berlin“ hinweist – als einen Gegenentwurf lesen, indem Hessel „die unmittelbare Gegenwart so schilderte, als sei sie schon Erinnerung.“ Die Ergebnisse sind auch heute äußerst lesenswert, gerade weil sie aus jeder Zeit, jedoch nicht aus der Welt, gefallen sind.
• Franz Hessel
Heimliches Berlin
Roman
Mit einem Nachwort von Manfred Flügge.
Einbandgestaltung unter Verwendung eines Gemäldes von Peter K. Kirchhof.
Lilienfeldiana Band 12
150 Seiten
Halbleinen, Fadenheftung, Leseband
€ 18,90
ISBN 978-3-940357-23-6
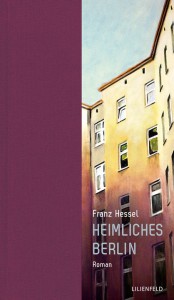
Für den Einband verwendete der Lilienfeld Verlag ein Fragment aus dem Gemälde „Ein Stück Himmel“ (2003) von Peter K. Kirchhof
• Franz Hessel
Laura Wunderl
Münchner Novellen
Hg. und mit einem Nachwort von Dirk Heißerer.
128 Seiten, Geb.
€ 18,50
ISBN 3-87410-079-0