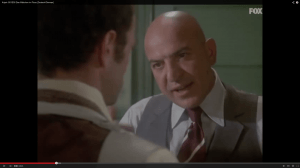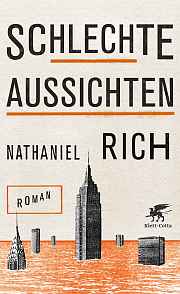Duell der Giganten: Gil Mehmert inszeniert am Broadway ein Stück über Bernstein und Karajan

Gil Mehmert, der an der Folkwang Hochschule Essen lehrt, setzt Bernstein und Karajan am Broadway in Szene. Foto: Felix Rabas
Gil Mehmert goes Broadway: Der Regisseur, der seit 2003 im Fachbereich Musical an der Folkwang Hochschule in Essen lehrt und in den Theatern im Revier kein Unbekannter ist, hat sich in New York mit einem Stück über zwei Dirigier-Giganten des 20. Jahrhunderts vorgestellt.
Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, jedem Musikfreund ein Begriff, trafen sich zum letzten Mal 1988 im legendären Hotel Sacher in Wien. Die beiden Rivalen um Marktmacht und musikalische Meinungen verbrachten eine Nacht in der „Blauen Bar“, mit einem einzigen Zeugen, dem Kellner. Der bemerkt dreißig Jahre später, wie der amerikanische Schriftsteller, Filmemacher und Komponist Peter Danish Bernsteins Gesammelte Briefe liest, erzählt ihm von dieser Begegnung – und der fantasiebegabte Autor füllt die dürre Information mit Leben und imaginiert die Inhalte des nächtlichen Gesprächs. Peter Danish kennt die Welt der klassischen Musik gut; sein Debütroman „The Tenor“, 2014 erschienen, erzählt auf der Basis der frühen Biografie von Maria Callas die Geschichte eines jungen Opernsängers, dem der Zweite Weltkrieg die Karriere ruiniert.

Begegnung im Hotel Sacher: Leonard Bernstein (Helen Schneider) und Herbert von Karajan (Lucca Züchner); in der Mitte der Kellner als einziger Zeuge des Abends (Victor Petersen). Die Bühne schuf Chris Barreca, die Kostüme René Neumann. (Foto: Maria Barnova)
Mit „Last Call“, so der Titel des neuen, im März in New York uraufgeführten Stücks, wagt die junge Kölner Produktionsfirma apiro Entertainment den Sprung an den Broadway und hat mit Gil Mehmert einen erfahrenen Regisseur mitgenommen. Er hat u. a. „Cabaret“ an der Volksoper Wien und Michael Kunzes & Sylvester Levays „Elisabeth“ in Wien inszeniert. Seit er 2011 „Ganz oder gar nicht“ von David Yazbek und 2016 Webbers „Sunset Boulevard“ am Theater Dortmund auf die Bühne gebracht hat, ist er immer wieder als Regisseur auch in der Region hervorgetreten, so zuletzt mit Sondheims „Sweeney Todd“ in Dortmund und John Kanders „Chicago“ an der Oper Bonn.
„Last Call“ kreist 90 Minuten lang um Tiefsinn und Tratsch: Danish verwebt mit der leichten Hand des geübten „well made play“-Autors spritzige Pointen mit komplexen Themen. Es geht um die Art der Lebensführung – der ernsthafte Karajan versus den lockeren Lebemann Bernstein –, um die jüdischen Proteste gegen den Auftritt des im Dritten Reich regimenahen Österreichers mit mazedonischen Wurzeln 1955 in der Carnegie Hall, um Karajans Vergangenheit im Nazi-Reich und um Bernsteins unkonventionellen Zugang zur Musik, um Homosexualität und Lebensgenuss, um originäre und nachschöpferische Kreativität, aber auch um Selbstzweifel und Lebensbilanzen.
Und so spitzen die beiden Kontrahenten ihre Wortspiele zu und rüsten sich zum Duell der Taktstöcke. Das Publikum in einem der fünf „New World Stages“-Theater, einem Off-Broadway-Kulturkomplex, geht lebhaft mit: Viele Zuschauer sind zu jung, um die beiden Musik-Giganten noch persönlich erlebt zu haben. Wann und warum gelacht wird, lässt durchaus einen Generationen-Unterschied erkennen, aber das Florett der Worte touchiert auch die Jüngeren treffsicher. Man ist offenbar gut informiert. Und lässt sich auch von einer Debatte über den passenden Zugang zu Bruckner und Mahler mitreißen.

Helen Schneider als Bernstein. (Foto: Maria Barnova)
Weil es Gil Mehmert, wie er in einem Interview sagt, mehr auf die Seelen, Herzen und Gedanken als auf die äußere Erscheinung der beiden Protagonisten ankommt, hat er sie mit zwei Frauen besetzt: Helen Schneider, die brillante Musical-Darstellerin und Weill-Interpretin, gibt der Figur Bernstein die weltläufige Nonchalance, den souveränen Humor, eine heitere Gelassenheit, aber auch eine spitze Angriffslust und den beweglichen Intellekt. Ihre Mimik, wenn sie über Karajans Sottisen die Augen rollt oder seine künstlerischen Belehrungsergüsse mit einer beiläufigen Geste beiseite wischt, zieht Lacher und Sympathie auf ihre Seite.

Lucca Züchner als Karajan. (Foto: Maria Barnova)
Die Münchner Schauspielerin und Musicalsängerin Lucca Züchner schafft es als Karajan, dem Charmebolzen stand zu halten. Wie sie den alten, vom Schmerz gezeichneten Dirigenten mit den typisch nach hinten frisierten grauen Haaren durch die Szene wanken lässt, hat große Klasse. Bei ihr blitzt Karajans Energie auf, die sich aus dem Willen zu unbedingter Professionalität, künstlerischer Qualität, musikalischer Vollkommenheit speist. Sie verkörpert in manchmal schnarrender Härte, was der „echte“ Karajan in einem Spiegel-Interview 1979 gesagt hat: „Ich gehe auf keine Party. Was ich liebe, ist das Gespräch mit einem oder zwei Menschen, bei dem ernsthaft diskutiert wird. Mich interessieren eigentlich nur Leute, von denen ich was lernen kann. … Party-Geschwätz passt nicht in mein Dasein. Ich habe Besseres zu tun.“
Was für ein Gegensatz zu Bernstein, dem der Gesellschafts-Glamour und die „unterhaltende“ Musik wichtig war – was ihm Lucca Züchner mit vorschnellendem Zeigefinger auch vorwirft. Deutscher Ernst gegen amerikanische Lässigkeit: Solche Szenen belichten die Gegensätze in aggressiver Pointe, um sie Sekunden später witzig und leichtfüßig zu entschärfen, aber nicht zu verharmlosen. Schauspieler-Theater vom Feinsten, zu dem auch Victor Petersen als Kellner seinen Beitrag leistet.
Wenn Peter Danishs Dirigenten-Gefecht etwas vermissen lässt, dann ist es ein Spannungsbogen, der auf einen finalen Coup zuläuft. Sicher beeindruckt, wenn die alten Herren auf der Toilette alleine reflektieren und dabei die Zweifel und Wahrheiten ihrer Existenz streifen. Das Ende allerdings strebt nach Friede, Freude, Sachertorte; der „last call“ gibt sich versöhnlich im Zeichen der Musik. Ein Stück, das man in einer flotten deutschen Übersetzung gerne auf intimer Bühne oder bei Musikfestspielen wiedersehen würde – unterhaltsam reflektierend, wo Grenzen und Größe epochaler Musiker wie Bernstein und Karajan liegen.