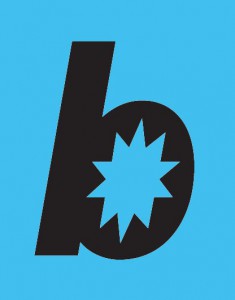Genozid in den afrikanischen Kolonien: Schauspiel Köln gibt Herero und Nama eine Stimme
Es war Völkermord: Der Theatermacher Nuran David Calis, der sich in Köln mit der Keupstraßen-Trilogie, in der er die NSU-Morde thematisierte, einen Namen gemacht hat, widmet sich nun in seiner neusten Uraufführung am Schauspiel Köln einem weiteren dunklen Kapitel der deutschen Geschichte: dem Genozid an den Herero und Nama, den die Kolonialmacht des Deutschen Kaiserreiches zwischen 1904-1908 im heutige Namibia in Südwestafrika verübte.
Formal geht er dabei bewusst über die Mittel des Dokumentartheaters hinaus, derer er sich zwar für die Veranschaulichung der Thematik bedient, die er aber hin zum Diskurstheater überschreitet.
Denn in Köln sitzen die Vertreter und Nachfahren der Herero und Nama mit auf der Bühne und formulieren explizit ihr Anliegen an die deutsche Gesellschaft, in diesem Falle das Publikum: Sie fordern eine Entschuldigung für das Leid, das ihren Großeltern und Urgroßeltern angetan wurde, sie fordern die Rückgabe von Artefakten und, so makaber es klingt, von sterblichen Überresten ihrer Vorfahren, die immer noch in deutschen Museen lagern. Und sie fordern Reparationszahlungen an die Herero und Nama.
Aktuelle Politik ragt in die Aufführung hinein
In New York haben sie Deutschland jüngst deswegen verklagt, der erste Versuch war nicht erfolgreich, die Klage wurde letzte Woche abgewiesen, aber die Nachfahren wollen in Berufung gehen, wie sie sogar auf der Bühne bekräftigen – so ragt die aktuelle Politik in die Aufführung hinein.
Ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt es allerdings schon, wie Talita Uinuses, Israel Kaunatjike und Julian Warner an einem altmodischen Kaffeetisch sitzen und ihre Geschichte erzählen. Dabei ist die Schilderung der Grausamkeiten teilweise schwer auszuhalten: Wie Menschen versklavt, gefoltert, getötet wurden, wird aus vielen historischen Dokumenten sowie Fotos und Filmen deutlich.
Beschämende Befunde
Im Hintergrund symbolisieren drei Schauspieler in die Kutten der ersten Missionare in Südwestafrika verkleidet und mit schauerlichen Masken angetan, den Umschlag von christlicher Nächstenliebe in Unterdrückung und Rassismus, je mehr die deutsche Kolonialmacht mit ihren gnadenlosen Militärs damals die Oberhand gewann.
Und, ja, es ist beschämend, wenn man so im Publikum sitzt und hört, wie Kolonialbeamte in Berlin 1906 in ihren Akten darüber schwadronieren, ob man nun zur Züchtigung der „Hottentotten“ lieber eine Nilpferdpeitsche oder ein Tauende benutzen sollte. Wer jetzt nicht über das üble Gift des Rassismus und wie es bis heute in Gesellschaften wirkt, nachdenkt, dem ist wohl tatsächlich nicht mehr zu helfen.
Wird das Leid letzten Endes ästhetisiert?
Allerdings nimmt die Inszenierung dann nochmal eine interessante Wendung, indem der Aktivist Julian Warner das ganze Unterfangen auf der Bühne in Frage stellt und die Aufführung selbst als Ästhetisierung des Leids für verfehlt erklärt. Der Schauspieler Stefko Hanushevsky widerspricht ihm heftig: Warum sollte man nicht mit theatralen Mitteln ein solches Thema verhandeln und die Zuschauer dafür sensibilisieren können? Dass darüber bis zum Schluss keine Einigkeit zu erzielen ist, ist fast folgerichtig.
Trotzdem hängen politischer Apell sowie dessen Umsetzung in bühnenwirksame Bilder irgendwie ein wenig in der Luft: Vielleicht, weil das Publikum den Diskurs letztlich nur als stumme Masse verfolgt und selbst nicht zum Akteur werden kann? Vielleicht weil die Gesellschaft, die hier angeklagt wird, nur teilweise im Zuschauerraum sitzt? Eines erreicht der Abend aber auf jeden Fall: Er lässt einen nicht kalt…
Karten und Termine: Schauspiel Köln