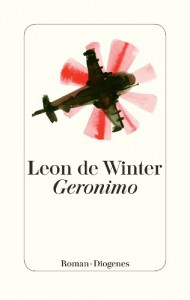Wenn Bin Laden noch leben würde – Leon de Winters Roman „Geronimo“
Dieser Roman könnte Stoff für Verschwörungstheorien liefern: Demnach ist Osama bin Laden nicht am 2. Mai 2011 von Eliteeinheiten der CIA in seinem Unterschlupf im pakistanischen Abbottabad umgebracht worden, sondern bei dieser Geheimdienstoperation ist ein Doppelgänger gestorben.
In Leon de Winters Roman „Geronimo“ (Codename für die Ergreifung von Bin Laden) lebt der Chef der Terrororganisation Al Kaida weiter, allerdings an einem von Militärs streng abgeschirmten Ort. Die USA und ihre Verbündeten möchten doch noch mehr über den Mann selbst, islamistische Gruppierungen sowie ihre Hintermänner in Erfahrung bringen. Es geht auch um einen geheimnisvollen USB-Stick. Der wiederum soll Informationen enthalten, dass der (scheidende) Präsident Obama in Wirklichkeit Muslim ist und nicht dem Christentum angehört.
Mal abgesehen von der Frage, wie geschickt es sich anlässt, gerade die religiöse Identität Obamas, die Rechtspopulisten immer wieder gern als Zielscheibe nutzen, in den Handlungsverlauf einzubeziehen, wirkt diese Episode auch sehr aufgesetzt und fügt den ohnehin schon zahlreichen und teils auch verwirrenden Handlungssträngen noch einen weiteren hinzu. Zudem lässt Leon de Winter auch vollkommen offen (wenn er denn schon bin Laden überleben lässt), wie es denn dann mit dem einst meistgesuchten Mann der Welt weitergegangen ist.
Der Autor bevorzugt es stattdessen, eine Geschichte zu erzählen, die den Terroristenchef als Menschenfreund erscheinen lässt. Durch Zufall trifft Osama eines Nachts, als er sein Versteckt verlässt und im Schutz der Dunkelheit Eis für seine Geliebten besorgen will, ein Mädchen namens Adana. Ihr haben Taliban (!) Ohren und Hände abgehackt, weil sie westliche Musik gehört hat, genauer gesagt Glenn Goulds Goldberg-Variationen. Die Kompositionen hat die aus Afghanistan stammende Jugendliche kennen und lieben gelernt, nachdem sie der US-Soldat Tom Johnson bei sich aufgenommen hatte. Ihre Eltern waren bei einem Angriff der islamistischen Milizen getötet worden. In die Hände der Terroristen gerät sie, weil die Taliban den US-Stützpunkt von Tom überfallen und sie mitnehmen. Adana schafft es aber, sich zu befreien und gelangt – wie es der Zufall will – nach Abbottabad. Die erste Begegnung mit Osama ist sehr spannungsgeladen, fragt er sich doch, ob er das Mädchen, das ihn trotz Verkleidung zweifellos erkannt hat, töten soll um seiner Sicherheit willen. Aber sie kann seine Sympathie gewinnen und er versteckt sie schließlich in einer Garage, versorgt sie mit Lebensmitteln.
Nachdem nun Bin Laden den Amerikanern ins Netz gegangen ist, beginnt für die junge Afghanin ein neuer und nicht weniger komplizierter Lebensabschnitt, mit dem der Autor die komplexen politischen und religiösen Gegebenheiten im mittleren Asien in den Blickpunkt rückt und zugleich auch auf internationale Verflechtungen eingeht.
Eine christliche Familie würde zwar gern Adana aufnehmen, fürchtet sich aber vor den Reaktionen einer überwiegend muslimischen Gesellschaft. Toms Bemühen, Adana außer Landes zu bringen, ist mit unüberwindbar scheinenden bürokratischen Hürden verbunden. Als er schließlich erfährt, dass sie nochmal Opfer eines Attentates geworden sein könnte, geraten alle Versuche, sein eigenes Lebensschicksal aufzuarbeiten, ins Wanken. Tom hat in Folge des Attentats von Madrid 2004 seine Tochter verloren. Und ihn plagen gegenüber Adana große Schuldgefühle, da er sie nicht ausreichend vor den Taliban hat schützen können.
Leon de Winters Buch lebt von Dynamik und Dramatik. Manchmal scheinen auch die Grenzen von Realität und Fiktion zu verschwimmen. Der Leser steht vor der Herausforderung, die Orientierung nicht zu verlieren.
Leon de Winter: „Geronimo“. Roman. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Diogenes Verlag, Zürich. 442 Seiten, 24 Euro.