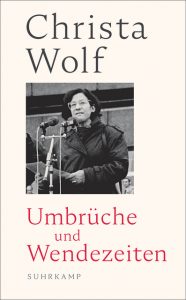Jubelnde Menschen in Ost und West: Diese Bilder prägten 2019 die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ein ungleich facettenreicheres Porträt der Wendezeit bieten indes die Interviews, die der Filmemacher und Publizist Thomas Grimm mit der Schriftstellerin Christa Wolf im Beisein ihres Mannes Gerhard Wolf vor elf Jahren geführt hat.
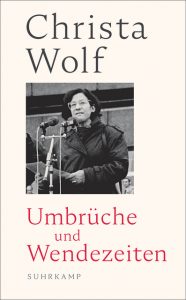
Jetzt hat Grimm die Gespräche gemeinsam mit dem Ehemann der 2011 verstorbenen Autorin aufbereitet und um Reden sowie weitere Dokumente erweitert – womit man sich mitten im Geschehen jener Jahre befindet.
„Für unser Land“ heißt ein denkwürdiger Aufruf, den Wolf und eine Reihe von Weggefährten aus Kultur, Kirche und Wissenschaft in den Novembertagen 1989 verfasst haben, wollten sie doch die DDR von der Basis her reformieren. Eine deutsche Einheit, die gern in einem Atemzug mit der Grenzöffnung genannt wird, war für sie nicht das vorrangige Ziel, wie es auch in Christa Wolfs Rede auf dem Alexanderplatz deutlich wird. Vielmehr hatten zahlreiche Intellektuelle vor Augen, „eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik“ zu schaffen – ohne Honecker & Genossen.
„In völlig andere Strukturen hinübergehoben““
Bekanntlich kam es anders, Kanzler Kohl habe schlau und geschickt agiert, resümiert die Schriftstellerin. Sehr feinfühlig, oftmals mit dem Neuen hadernd, gibt sie wieder, welche Entwicklung fortan ihren Lauf nahm. Man sei im Kulturbereich in völlig „andere Strukturen hinübergehoben worden“, heißt es an einer Stelle, an einer anderen beschreibt Christa Wolf die Veränderung an den Universitäten: „Über Nacht übernahmen die westdeutschen Gesandten die Gremien, und selbst hoch angesehene DDR-Wissenschaftler mussten sich von zweitklassigen Professoren aus dem Westen evaluieren lassen. Im Grunde blieb kein Stein auf dem anderen.“
Sozialistisch klingt es, wenn sie erklärt, dass mit der Einheit „das Privateigentum an den Produktionsverhältnissen“ wiedereingerichtet worden sei. So sehr sie das vereinte Deutschland mit vielen Bedenken betrachtet, so kritisch sieht sie aber auch das DDR-System, das die Menschen vereinnahmt, entmündigt und in ihrer Würde verletzt habe. Schließlich wirbt sie dafür, den einstigen DDR-Bürgern Verständnis entgegenzubringen, die es eben nicht gelernt hätten, ihre Meinung zu sagen und sich in demokratischen Spielregeln einzuüben.
Als ein Umbruch noch unwahrscheinlich zu sein schien
Dass sich in dem „Arbeiter- und Bauernstaat“ überhaupt ein Umbruch anbahnen könne, das schien der Schriftstellerin auch noch in den letzten Monaten vor dem Mauerfall unwahrscheinlich zu sein. Die Hoffnung, die DDR-Führung würde sozusagen von oben einen Wandel einleiten, haben nach Aussagen von Wolf wohl viele Bürger spätestens nach einem Interview mit Funktionär Kurt Hager im Jahr 1987 begraben. Auf die Frage, ob nicht Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion Vorbild für die DDR sein könne, stellte er sinngemäß die Gegenfrage, ob man, wenn der Nachbar die Wohnung neu tapeziere, das denn auch machen müsse.
Den Anfang vom Ende des Systems verortet Christa Wolf allerdings weniger in den Reformprozessen, die Gorbatschow einleitete, vielmehr habe der Zerfall bereits mit der Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermanns 1976 begonnen. En passant erwähnt Wolf, dass die Entscheidung Honecker ganz allein getroffen habe, selbst seine Ehefrau sei aus Angst um die Folgen dagegen gewesen. Nun sei zwar Biermann nicht besonders bekannt gewesen in der DDR, dass aber überhaupt jemand ausgebürgert wird und dann noch jemand, dessen jüdischer Vater im KZ umgebracht wurde, hat nach Wolfs Darstellung den Protest katalysiert.
Offene Worte über die Kontakte zur Stasi
Der Zusammenbruch 1989 geht, wie Christa Wolf anschaulich beschreibt, auf mehrere Ereignisse zurück, wozu Aktionen der Friedens- und Bürgerrechtsbewegung ebenso gehören wie die öffentlichen Berichte zu den Manipulationen bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 und schließlich die Übergriffe der Staatsmacht bei den Demos im folgenden Oktober. Wie schwierig die Aufarbeitung solcher Vergehen sich gestalten kann, darauf geht Christa Wolf ein, als sie über ihre Mitarbeit in der Untersuchungskommission berichtet, die beispielsweise einen Erich Mielke interviewen musste. Sehr offen spricht sie über ihre Kontakte zur Stasi, berichtet davon, wie überrascht sie bei Sichtung der eigenen Akten gewesen sei, als IM geführt worden zu sein. Ihre kritische Haltung zu Partei und Staat, so mutmaßt Wolf, habe wohl dazu beigetragen, dass man an ihr als Informantin dann doch wohl kein Interesse hatte. Selbst hätte sie es sowieso nicht gewollt.
Wenn man heute ein solches Buch liest, das vertiefende Einblicke in Strukturen und Zusammenhänge der DDR bietet, kommt unweigerlich die Frage auf, ob sich irgendwo Erklärungsmuster für das Erstarken von Populismus und Rechtsextremismus finden. Einen Hinweis gibt Christa Wolf direkt selbst. Der Aderlass an jungen Menschen gleich mit Öffnung der Mauer hat nach ihrer Ansicht die ostdeutsche Gesellschaft anfälliger für solches Gedankengut gemacht. Zudem hebt Wolf darauf ab, wie sehr doch eine ablehnende Haltung gegenüber dem Staat während in der DDR ausgeprägt war, woraus sich die Frage ergibt, welche Folgen das für eine spätere Gesellschaft haben kann. Und schließlich spricht sie davon, dass – wenn auch eher auf alternative Lebensformen bezogen – sich Menschen in Zirkeln und Vereinigungen Nischen suchen, um der Globalisierung zu entkommen.
Christa Wolf: „Umbrüche und Wendezeiten“, hg. von Thomas Grimm unter Mitarbeit von Gerhard Wolf, Suhrkamp, 141 Seiten, 12 Euro.