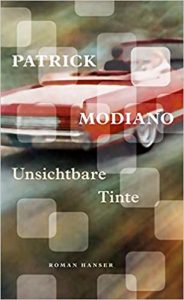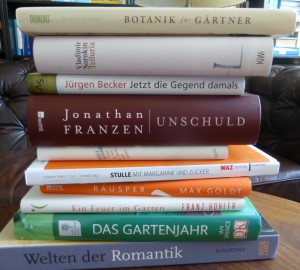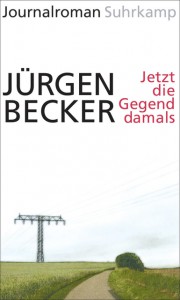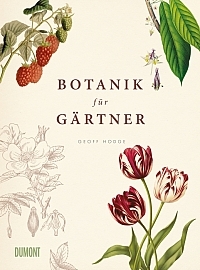Die schmerzliche Wahrheit zulassen – Patrick Modianos Roman „Unsichtbare Tinte“
Als Patrick Modiano 2014 den Nobelpreis für Literatur erhielt, hieß es in der Begründung der Jury, sein Werk stehe für „die Kunst des Erinnerns, mit der er die unbegreiflichsten menschlichen Schicksale wachgerufen und die Lebenswelt während der deutschen Besatzung sichtbar gemacht hat.“ Auch in Modianos neuem Roman „Unsichtbare Tinte“ dreht sich alles um das Emporziehen von Ereignissen und Einbildungen aus den Tiefen des Unbewussten – und darum, ob Erkenntnis überhaupt möglich ist.
Ging es Modiano früher eher darum, gegen das Verdrängen und Vergessen von Nazi-Verbrechen anzuschreiben und das Schicksal von jüdischen Menschen zu rekonstruieren, die während der Nazi-Zeit spurlos verschwanden, so umkreist er jetzt die Frage, ob die Erinnerung und die Suche nach der verlorenen Zeit überhaupt Wirklichkeit abbilden und Wahrheit ans Licht bringen kann.
Studentenjob in der Detektei
Es ist die Geschichte von Jean Eyben, der seit vielen Jahren ein Rätsel mit sich herumschleppt: Jean war Mitte der 1960er Jahre knapp zwanzig, ein Student auf der Suche nach einer Bestimmung und Aufgabe in seinem Leben, als er für ein paar Wochen in einer Pariser Detektei anheuerte und auf den Fall einer verschwundenen jungen Frau angesetzt wurde, Noelle Lefebvre. Damals konnte er den Fall nicht lösen, die Frau war wie vom Erdboden verschluckt: Jean ist dann auch bald aus der Detektei wieder ausgestiegen und hat einen anderen Lebensweg eingeschlagen, sich mit Literatur und Kunst beschäftigt.
Doch das schmale Dossier zum Fall Noelle Lefebvre hat er damals mitgehen lassen und immer bei sich getragen. Es dient ihm jetzt, viele Jahre später, dazu, sich alles noch einmal zu vergegenwärtigen und aufzuschreiben: wie er durch Paris irrte, Bekannte und Arbeitskolleginnen der Verschwundenen ausfindig machte und befragte, dabei auf seltsame Widersprüche stieß und ihm schwante, dass Noelle eine Art Luftgeist war, ein geheimnisvolles Wesen, über das sich alle ihre eigenen Wahrheiten und Lügen zurechtgelegt hatten.
Das Tagebuch von Noelle, das Jean in ihrer Wohnung gefunden hat, bringt ihn nicht weiter, denn es ist mit „unsichtbarer Tinte“ geschrieben: Seiten, auf denen damals gar nichts vermerkt war, offenbaren jetzt plötzlich, weil die Tinte inzwischen wieder sichtbar wurde, Bemerkungen von Noelle, die Jean aber nicht entschlüsseln kann. Er bemüht sich zwar, den Nebel zu lichten, seine Erinnerungen mit Fakten zu füllen, aber alles bleibt – damals wie heute – verschwommen und rätselhaft.
Meister der literarischen Wendungen
Modiano ist ein Meister der poetischen Täuschung und der literarischen Wendungen. Wenn sich Jeans Erinnerungen als falsch erweisen, er beim Schreiben der Geschichte das Gefühl hat, alles sei bereits längst mit „unsichtbarer Tinte“ von irgendwem irgendwo aufgeschrieben, sein Schreiben diene nur dazu, sich seiner Geschichte zu stellen und sich einzugestehen, was ihn wirklich mit Noelle verbindet, dann bekommt alles noch einmal einen unerwarteten Dreh, wird die Erzähl-Perspektive verändert, werden alle Erinnerungen in ein anderes Licht gestellt, erhalten alle Fakten eine neue Bedeutung: Es kommt immer darauf an, welche Erinnerungen man zulässt, welche man lieber im Verborgenen belässt. Ob man bereit ist, der Wahrheit ins Auge zu sehen.
Die Wahrheit über den Fall der verschwundenen Noelle schlummerte schon immer in seinem Unbewussten, Jean muss sie nur zulassen. Und der Erzähler, der jetzt nicht mehr Jean ist, muss sich als jemand erweisen, der Schreiben als Suchbewegung begreift, als ein Herantasten an das, was passiert ist oder sein könnte. Die schmerzliche Wahrheit hat etwas mit der verdrängten Kindheit und problematischen Jugend von Jean zu tun, mit seiner Herkunft und damit, dass Erkennen meistens ein plötzliches Wieder-Erkennen ist.
Die Geschichte von Noelle, ihr Leben und ihr Verschwinden, wird sich – Simsalabim! – als ziemlich unspektakulär entpuppen. Die Lösung des Rätsels kennt nur Jean, der mit dem Schreiben eine Wirklichkeit erfinden kann, die es gar nicht gibt. Der Roman hat magische Züge, lässt manches aufscheinen, bevor es wieder verblasst, sich auflöst und vielleicht später wieder in anderem Licht eine neue Bedeutung bekommt. Es scheint, als habe Modiano seinen Roman selbst mit „unsichtbarer Tinte“ geschrieben.
Patrick Modiano: „Unsichtbare Tinte.“ Roman. Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. Carl Hanser Verlag, München 2021, 126 S., 19 Euro.