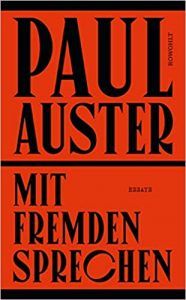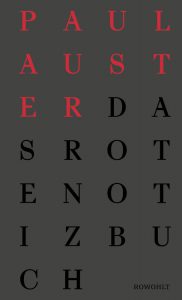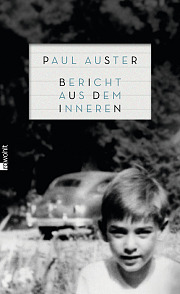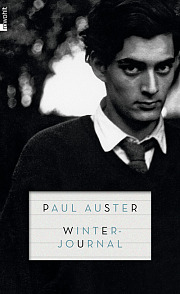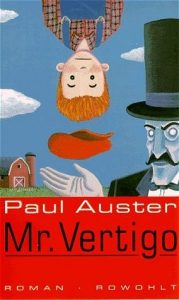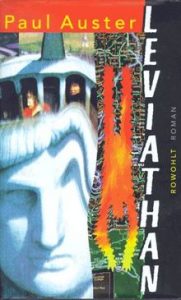Dem Tod gefasst entgegensehen – Paul Austers Roman „Baumgartner“
Ein doppeltes Missgeschick wirft das Gedanken-Karussell des Erzählens an: Zuerst hantiert Professor Seymour T. Baumgartner (genannt „Sy“), emeritierter Phänomenologe und Schriftsteller aus Princeton (USA), höchst ungeschickt mit einem glühend überhitzten Topf. Kurz darauf stürzt er eine Treppe hinunter. Slapstick mit schmerzlichen Folgen.
Doch da ist ein bleibender, ungleich tieferer Schmerz, der phantomhaft fortwirkt: Vor einigen Jahren ist Anna, die Frau seines Lebens, wider seinen Rat abends noch einmal zum Schwimmen ins Meer gegangen und von einer tödlichen Monsterwelle erfasst worden. Wie kann der Hinterbliebene das aushalten? Zitat: „Leben heißt Schmerz empfinden, sagte er sich, und in Angst vor Schmerz zu leben, heißt das Leben verweigern.“ Für eine solche Einsicht muss das Ereignis wohl schon eine Weile zurückliegen.
Seit Annas Tod schwindet jenes Gefühl nicht mehr, dass einem immer und überall etwas zustoßen kann. Aus dem andauernden Bewusstsein von Endlichkeit und Vergänglichkeit erwächst hier mit der Zeit Gefasstheit, während die Panik sich nach und nach vermindert.
Auf schwankendem Boden
Gleichwohl: Auf unsicherem, schwankendem Boden bewegt sich Paul Austers Roman „Baumgartner“, der aus Reflexionen und Erinnerungen des nunmehr 71 Jahre alten Witwers besteht; freilich nicht in der Ich-Form, sondern distanziert in der dritten Person wiedergegeben, doch kaum minder eindringlich. Es stehen nun solche Fragen an: Wie viel Zeit bleibt noch auf Erden? Was geschieht nach dem Tod? Besteht dann noch eine geheime Verbindung mit einst geliebten Lebenden?
„Er ist jetzt einundsiebzig, in sechs Wochen steht der nächste Geburtstag an, und ist man erst einmal in dieser Zone schrumpfender Perspektiven angelangt, muss man mit allem rechnen.“ Gekommen sind demnach die Zeiten, in denen nicht nur generell das Gedächtnis nachlässt, sondern man auch öfter vergisst, den Hosenstall zuzumachen. Das Altern als lachhaft traurige Groteske… Aber wäre es denn besser, so früh, selbstgewiss, kühn und aufrecht in den Tod zu gehen wie seinerzeit Anna?
Lektüre unter anderen Vorzeichen
Unterdessen schweifen Baumgartners Gedanken in die Vergangenheit. Es ziehen so manche Szenen aus seinem Leben noch einmal vorüber; besonders aus der Frühzeit, als er Anna kennenlernte, die damals zunächst den Ehrgeiz hatte, Baseball-Spielerin zu werden, um es den Jungs zu zeigen. Ein Paar wurden sie erst nach etlichen Jahren, vor dem Zeithorizont des Vietnamkriegs und der heftigen Proteste dagegen. Durch Zufall sind sie einander wieder begegnet, doch auch wie vorherbestimmt. Es wurde eine anfangs wild erotische, sodann zunehmend intellektuell bereichernde Partnerschaft.
Austers treue Leserinnen und Leser mögen hierbei an sein reales Leben mit der ebenfalls ruhmreichen Schriftstellerin Siri Hustvedt denken. Es bleibt ihnen unbenommen. Aber in derlei Analogien geht dieses Buch natürlich längst nicht auf. Seit Siri Hustvedt die (literarische) Welt hat wissen lassen, dass Paul Auster an einer schweren Krebserkrankung leidet, liest man einen solchen Roman allerdings unter anderen Vorzeichen und mit anderen Regungen. Je nach Lebensalter dürften sich zudem verschiedene Lektüren ergeben. Doch darunter sollte keinerlei fruchtlose Lektüre sein.
Ukraine als Zone des Schreckens
Die Rückblicke führen jedenfalls über die wechselhafte Lebensgeschichte der Eltern (welche Optionen hatten sie, welche haben sie genutzt?) bis in die Kindheit und weiter hinab zum Gedenken an den jüdischen Großvater in der Ukraine, wo Baumgartner sich viele Jahrzehnte später – am Rande einer PEN-Autorentagung – in der entsprechenden Region um Lwiw umsehen konnte. In der Gegend sind viele Gräuel des 20. Jahrhunderts kulminiert, sie war wiederholt eine Zone schrecklichen Massensterbens. Dieser Roman schildert eben keine rein persönliche Geschichte, er umgreift auch das Weltgeschehen. Übrigens erinnert sich Auster und mit ihm Baumgartner in diesem Zusammenhang an ein deutsches Gedicht, das Georg Trakl in jenen Breiten über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat. Es heißt „Im Osten“ und endet mit der Strophe:
Dornige Wildnis umgürtet die Stadt.
Von blutenden Stufen jagt der Mond
Die erschrockenen Frauen.
Wilde Wölfe brachen durchs Tor.
Gegen Ende hin scheint die Handlung gleichsam ein wenig ins Schlingern zu geraten, als würde es Auster aus der Kurve tragen. Auch Baumgartner hat ein Buch mit dem Titel „Rätsel des Steuers“ vollendet, das sich zwischen Aristoteles und allerlei Erwägungen zum „autonomen Fahren“ ergeht. Er fragt sich selbst, ob etwa seine Kraft zum Schreiben nachgelassen habe. Auch hier also das Menetekel des Alterns. Doch noch einmal, ein letztes Mal, so scheint es, hat er einen Text auf eigener Höhe verfasst.
An wessen Türe klopft er schließlich an?
Es geht derweil nicht nur um Todesnähe und Zeitvergang, sondern zuinnerst auch um die Liebe. Nach Jahren der flehentlichen Trauer hatte Baumgartner jüngst eine Affäre, aus der mehr zu werden schien und aus der dann doch nichts geworden ist. Und nun? Hat sich eine junge, offenbar ausgesprochen kluge und vitale Wissenschaftlerin gemeldet, die sehr eingehend über Annas vorliegendes und verborgenes Werk forschen möchte, wobei ihr Baumgartner sicherlich am besten helfen kann. Er lädt sie auf unbestimmte Dauer ein, lässt eigens ein Einlieger-Apartment für sie herrichten, blüht auf vor lauter Vorfreude, ja Vor-Verliebtheit. Ist sie nicht gar so etwas wie eine wiedergeborene Anna? Als sie im fernen Bundesstaat losfährt, macht er sich ungeheure Sorgen wegen der Wetterverhältnisse. Ob und wann diese Beatrix („Bebe“) Coen bei ihm eintrifft, erfahren wir jedoch nicht mehr. Der Roman nimmt ein jähes Ende, das ins Leere zu laufen scheint. Ob es auch im Nichts endet, steht dahin.
An diesem Ende geschieht abermals ein Unfall, diesmal mit dem Auto, in das sich Baumgartner gegen alle Vernunft beim widrigem Winterwetter gesetzt hat. Er scheint nur leicht verletzt zu sein und selbst Hilfe in einem nahegelegenen Haus aufsuchen zu können. Doch dann klingt es in den vieldeutigen Schlusssätzen so, als habe er vielleicht nicht bei gewöhnlichen „Leuten“, sondern an die Tür des Todes geklopft. Welch ein rätselvoller Aus- und Übergang. Niemand weiß mehr.
Paul Auster: „Baumgartner“. Roman. Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Rowohlt, 204 Seiten, 22 Euro.