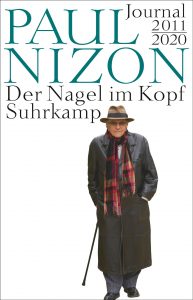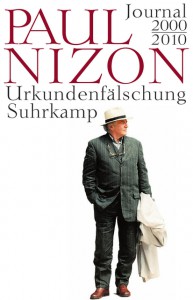Der Stadtnomade als alternder Mann – Paul Nizons Journal „Der Nagel im Kopf“
Der Schweizer Schriftsteller Paul Nizon, seit vielen Jahren in Paris lebend, ist mittlerweile 91 Jahre alt. Es erscheint durchaus als altersgerecht, wenn er in seiner jüngsten Journal-Sammlung weit, weit zurückblickt. So erinnert er sich an Liebschaften, die etliche Jahrzehnte zurückliegen oder gar an die ersten weiblichen Lockrufe, die ihn zur Frühzeit ereilten, überhaupt an die Phasen der „Lebens-Anwärterschaft“, die hernach zum Antrieb seines Schreibens geworden sind.
Der vielfach – zumal in der schreibenden Zunft – verehrte Nizon (ein kostbares Hauptwerk: „Das Jahr der Liebe“ von 1981) ist nie ein Autor für die Menge gewesen, aber einer, der aus der neueren deutschsprachigen Literatur schwerlich wegzudenken ist; erst recht nicht aus französischer Perspektive besehen. Nach wie vor schreibt Nizon seine Bücher auf Deutsch. Wie er auch in seinem Band „Der Nagel im Kopf“ darlegt, betrachtet er sich selbst als einen Miturheber „autofiktionalen“ Schreibens und hält abermals fest, dass seine Literatur weit überwiegend aus Ablagerungen des Selbsterlebten bestehe – und nicht aus freischwebendem Fabulieren.
Unerfülltes Begehren in Rom
Als gar nicht so geheimes, weil wiederholt beschworenes Kraftzentrum auch dieses Buches erweist sich das italienische Erlebnis mit einer gewissen Maria, das den eingestandenermaßen „frauensüchtigen“ Mann seither verfolgt – obwohl oder gerade weil sie den Liebesakt damals nicht vollzogen haben. Die (Nicht)-Affäre und das unerfüllte Begehren sowie die Begleitumstände (seinerzeit lief ein bestürzender KZ-Film im römischen Kino) haben offenbar innig mit seiner kompromisslos anspruchsvollen Künstlerwerdung zu tun. In diesem Zusammenhang steht ein nie ausgeführtes Romanprojekt mit dem Arbeitstitel „Der Nagel im Kopf“ seit Dezennien im Raum. Nun heißen die von 2011 bis 2020 (Corona taucht nur knapp auf) entstandenen Aufzeichnungen so. Zitat: „… das Entsetzen hat sich mir eingebrannt. Es ist in mir steckengeblieben wie ein Nagel im Kopf.“
„So viel Tod“
Durch das Journal ziehen sich Stimmungsschwankungen zwischen Selbstmitleid und Selbstüberhöhung. Die allmähliche Alters-Verdunkelung mit ihren Schwächungen und Gebrechlichkeiten ist ein fortlaufendes Thema, daraus resultierend auch Einsamkeits-Gefühle, denn nach und nach sterben viele seiner Zeitgenossen und Weggefährten, seine Alters-Kohorte „dünnt aus“: „So viel Tod. Und in den Zeitungsmeldungen räumt der Tod die paar Überlebenden meiner Generation weg.“
Manche Passagen mögen dünkelhaft oder hochmütig wirken, andere wiederum ausgesprochen verzagt und entkräftet. Paul Nizon kreist nun einmal sehr um sich selbst. Andernfalls gäbe es sein Oeuvre nicht, jedenfalls nicht das vorhandene. Er sorgt sich um seinen Nachruhm und fragt sich immer wieder, was wohl von seinem Lebenswerk bleiben werde. Hin und wieder vergleicht er sich mit weltweit populären Erfolgsautoren wie etwa John Irving. Doch die eigentlichen Bezugsgrößen sind Schriftsteller wie Robert Walser, Elias Canetti oder – auf andere Art – der gleichfalls in Paris lebende Peter Handke.
Wo der Weltgeist waltet
Apropos Paris: In dieser Metropole waltet für Nizon sozusagen der vitale, stets sich erneuernde Weltgeist in allen Schattierungen. Nizon denkt an sein ruheloses „Stadtnomadentum“ mit vielfach wechselnden Ateliers („Schreibbuden“) in allen möglichen Arrondissements zurück. Wie anders als die enge, ängstliche Schweiz erscheint ihm diese leuchtende Weltstadt mit ihrer ganz anderen Lebensart! Doch an einem Demo-Tag, an dem das halbe Pariser Zentrum verstopft ist, ergreift ihn eine Panik der Ausweglosigkeit. Überhaupt sieht er Frankreich in den Zeiten der Gelbwesten-Proteste kurz vor einem Bürgerkrieg. Den Präsidenten Macron hält er übrigens für schrecklich profan – im Gegensatz zu Politikern vom Format eines Mitterrand. Zwischendurch beschreibt Nizon seine Haltung zu Ereignissen wie dem Tod des Popstars Johnny Halliday und dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame, die je auf ihre Weise die französische Nation bewegt haben.
Den anfangs stets unsicheren Einkünften zum Trotz, bereut Nizon keinesfalls seine frühzeitige Entscheidung gegen ein Angestellten-Dasein und für seine künstlerische Existenz par excellence. Nicht nur in Paris und Rom hat er gelebt, sondern zeitweise auch in Barcelona und London. Einen Flaneur und fiebrigen Frauensucher wie ihn kann man sich eigentlich nur in solchen Städten vorstellen, nie und nimmer auf dem Lande oder an wenig bedeutsamen Orten. Auch Zürich und Bern waren ihm nicht genug.
Paul Nizon: „Der Nagel im Kopf“. Journal 2011-2020. Suhrkamp Verlag, 263 Seiten, 26 Euro.