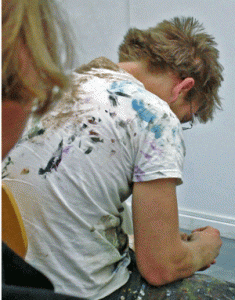Kliffhänger mit einem Schuss Sakralkitsch: Ruhrtriennale zeigt die Performance „Falaise“

Weiß auf Schwarz: Mit „Falaise“ (Klippe) hat das Kollektiv Baro d’evel ein Gegenstück zu seiner Produktion „Là“ geschaffen. (Foto: François Passerini/Ruhrtriennale)
Sie sind immer kurz vor dem Absturz. Krallen sich mit den Fingerkuppen fest, an Vorsprüngen in der senkrechten Wand. Kraxeln weiter, zwängen sich durch Löcher, die sie zuvor mit den Füßen durch Wände gestoßen haben. Denn auf dieser Bühne sind die Kulissen aus Gips. Was nach Felsen aussieht, bröckelt, bröselt, gerät als Geröll ins Rutschen. Wo ist da noch Halt? „Falaise“ (Klippe), eine Performance des französisch-katalanischen Kollektivs Baro d’evel, zeigt eine Welt kurz vor dem Kollaps – und acht Menschen, die sich durchhangeln.
Die Ruhrtriennale, die das Stück in der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks als Deutsche Erstaufführung zeigt, hat damit eine Produktion eingekauft, die sich in keine Schublade stecken lässt. Was Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias und ihr Ensemble geschaffen haben, passt zu den genreübergreifenden „Kreationen“, die seit Gründungsintendant Gerard Mortier ein Markenzeichen des Festivals sind.

Wer aufsteigt, kann auch fallen: Szene aus der Produktion „Falaise“ (Foto: Caroline Seidel/Ruhrtriennale)
In „Falaise“ trifft das moderne Tanztheater auf den Zirkus, denn ein Pferd und ein Taubenschwarm spielen ebenfalls mit. Ein paar Szenen liebäugeln mit der Barockoper. Das achtköpfige Ensemble singt und tanzt, zeigt Slapstick-Komik und eine Artistik, bei der die Gefahr von Knochenbrüchen durchaus einkalkuliert scheint. Waghalsig stürzt es sich von meterhohen Bühnenwänden herab, hangelt an Gerüsten, schlägt Salti, bildet ein Knäuel aus Leibern, das sich krakengleich über den Boden bewegt.
Eine Handlung gibt es nicht: In einem dystopischen Raum zeigt die teils improvisierte Performance Variationen von Aufstieg und Fall, Chaos und Anmut, Zerfall und Erneuerung. Was gesprochen wird, oft in hektischer Suada und hoher Fistel, ist – wie bei einer Clownsnummer – nicht so wichtig. Baro d’evel lädt Szenen mit Bedeutung auf, bis sie zur Metapher werden.
Zuweilen ist das plakativ. Wie erstarrt wirken beispielsweise ein Mann und eine Frau in Gipskleidung, die nach und nach von ihren Körpern abplatzt, je mehr sie sich für Bewegung entscheiden. Danach stehen sie – Achtung, Symbolik! – in einem Scherbenhaufen. Die schwarzen Wände bemalen die Ensemblemitglieder nach und nach mit Zeichen in weißer Farbe. Immer wieder lassen sie sich aus erheblicher Höhe fallen, als wollten sie Verse von Hölderlin nachspielen: „Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, Jahr lang ins Ungewisse hinab“, schrieb der Dichter in „Hyperions Schicksalslied“.

Die Interaktion zwischen Mensch und Tier fasziniert in der Performance „Falaise“ (Foto: Caroline Seidel/Ruhrtriennale)
Für poetische Bilder sorgen das weiße Pferd und die weißen Tauben. Sie bilden den Lichtblick auf der düsteren Bühne, den Gegenpol zum menschlichen Aktionismus. Wenn dazu noch Barockmusik eingespielt wird, ist die Grenze zum Sakralkitsch erreicht. Das muss dem Kollektiv wohl selbst aufgefallen sein, denn es versucht, solche Momente ironisch zu brechen. Wenn einer der Performer eine Barockarie eher jault und kräht als singt, ist es mit der Pseudoreligiosität natürlich schnell vorbei.
Kichern und Glucksen ist im Publikum nicht nur an dieser Stelle zu vernehmen. In „Falaise“ trifft der Weltuntergang auf Buster-Keaton-Komik und anarchische Fröhlichkeit. Zugleich weiß natürlich jeder im Saal, was die Stunde geschlagen hat. „Hier sind überall Löcher!“, ruft eine der Tänzerinnen gegen Ende. Bevor das Pferd alleine auf der Bühne zurückbleibt und der Vorhang fällt, fragt eine andere: „Und was machen wir morgen?“
(Karten und Informationen: https://www.ruhrtriennale.de/de/programm/falaise/187)