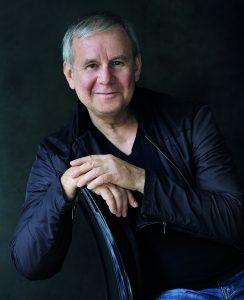Berührende Tragödie: Cecilia Bartoli mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ in der Essener Philharmonie

Cecilia Bartoli. (Foto: Fabrice Demessence)
Es sind keine Blumenkränze und Myrtengirlanden, die der Chor in ein Grab streut: In den abgedunkelten Saal der Philharmonie Essen zieht er mit Kerzen ein, während das Orchester die erhabenen Weisen der Ouvertüre Christoph Willibald Glucks zu „Orfeo ed Euridice“ intoniert. Weinen, Klagen, Seufzer beschwören die Sängerinnen und Sänger in abgedunkeltem Klang.
Am Rand der Szene sitzt Orfeo, der seine über alles geliebte Gefährtin an die Unterwelt verloren hat. Sein sehnsuchtsvoller Ruf „Euridice“ durchbricht die melodische Linie des Chores – und schon mit diesem Moment hat Cecilia Bartoli ihr Publikum gefangen.
Mit „Orfeo ed Euridice“, der wohl bekanntesten Oper des Ritters Gluck, hat die Römerin bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2023 einen Riesenerfolg eingeheimst. Nun tourt sie mit dem Ensemble durch Europa. Die Inszenierung Christof Loys bleibt dabei zu Hause in Salzburg, wo Cecilia Bartoli seit 2012 als Festspielchefin amtiert. Doch auch ohne Johannes Leiackers strenge, reduzierte Bühne vermitteln Bartoli und ihre Salzburger Bühnenpartnerin Mélissa Petit als Euridice (und in kurzem Auftritt auch als Amor) die bezwingende Präzision der Personengestaltung Loys.
Zu Beginn sitzt Bartoli ganz in Schwarz abseits auf einer Stufe des Podiums, ruft ihre Klage in den Raum, bewegt sich später auf den Treppen seitlich der Zuschauerreihen, trifft vor dem Podium auf Euridice, die Orpheus vergeblich aus dem Elysium zurück auf die Erde zu holen versucht. Die beiden Sängerinnen schaffen intime Momente seelischer Kommunikation: Cecilia Bartoli, jetzt ganz in Weiß, krümmt sich im ausweglosen Schmerz, weil sie der argwöhnischen Euridice das Verbot, sie anzublicken, nicht erklären darf.
Freudige Überraschung – fataler Trotz
Bei Mélissa Petit wandelt sich die freudige Überraschung, die Erwartung eines neuen Lebens in Liebe zu Orpheus, in Argwohn, Enttäuschung und fatalen Trotz: Lieber im Elysium friedliche Ruhe genießen als mit einem unberechenbaren Partner zur irdischen Liebe zurückkehren. Dann der aufwühlende Moment, der gegenseitige Blick in die Augen, der Euridice zurück in den Hades verbannt. Und am Ende namenlose Verzweiflung und Herzensleere bei Orfeo. Melissa Pétit findet dafür mit ihrem sanft leuchtenden, manchmal etwas kopfigen Sopran ergreifenden Ausdruck ratloser Seelenqual.

Christoph Willibald Gluck. Statue im Opernhaus Nürnberg. Gluck stammt aus Erasbach bei Berching, rund 50 Kilometer südöstlich von Nürnberg. (Foto: Werner Häußner)
Der Trost des „glücklichen Endes“ bleibt bei dieser Version versagt. Dieser „Orfeo“ folgt einer Fassung, die Gluck für die Hochzeit von Erzherzogin Anna Amalia von Österreich, einer Tochter Maria Theresias, mit Ferdinand, Herzog von Parma, im Jahr 1769 erstellt hat. Als einer von vier Einaktern war die Bearbeitung Teil eines luxuriösen apollinischen Festes beim Palast von Colorno. Bartolis Salzburger Fassung verzichtet auf das Finale, in dem Gott Amor die Liebenden endgültig zusammenführt. Die „azione teatrale“ – ergänzt durch populär gewordene Orchesterstücke wie den Furientanz und den „Reigen seliger Geister“ – endet in nachtschwarzer Pianissimo-Verzweiflung.
Glänzender Chor, feinsinniges Orchester
In solchen fragilen musikalischen Momenten glänzt der von Jacopo Facchini einstudierte Chor mit dem passenden Namen „Il Canto di Orfeo“, wenn er die Klage des Anfangs in subtilen dynamischen Nuancen wiederholt. Für Orfeo ist der Weg nun klar: „Erwarte mich, angebeteter Schatten!“, singt Cecilia Bartoli in resigniertem Schmerz. Der Chor breitet schon vorher die leisen Töne elegisch aus, trumpft aber auch auf mit markanter Artikulation und konzentrierter Energie in den Szenen in der Unterwelt. Bei allem Nachdruck pflegen die zwanzig Sängerinnen und Sänger einen geschmeidigen, gewaltlosen Klang mit leuchtender Transparenz, geschult an der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, die sonst ihren auf hochgeschätzten CD-Aufnahmen dokumentierten Schwerpunkt bildet.
Auch das Orchester „Les Musiciens du Prince – Monaco“, 2016 auf Initiative von Cecilia Bartoli in Monte Carlo gegründet und seither regelmäßig in Salzburg zu Gast, pflegt feinsinnige Tugenden wie ein locker-luftiges Klangbild, Respekt vor den Farben einzelner Solo-Instrumente, ausgewogene Balance der Instrumentengruppen, variable Tonbildung, ohne die Ästhetik des Klangs aufgeraut expressiv zu beeinträchtigen. Das führt weg von der Glätte, mit welcher der „Klassizist“ Gluck früher marmorn – und nicht selten langweilig – aufpoliert wurde. Wo der Komponist aus der Oberpfalz in harmonische Tiefen reicht, fächern die Musiker den Klang fast barock ziseliert auf; wo er die Einfachheit einer melodischen Linie lediglich akkordisch stützt, wird die viel zitierte „stille Größe“, die von Johann Joachim Winckelmann für die antike Skulptur reklamierte „große und gesetzte Seele“ in der Musik hörbar.
Gianluca Capuano leitet sein Ensemble mit ausgewogener Umsicht und Gespür für Farben und Schattierungen. Der Falle des Saals entkommt er nicht ganz: In dicht besetzten Momenten wird das Klangbild schwummrig; auch hätte der Bass, der Raumgröße Tribut zollend, eine Verstärkung verdient. Wundervoll aber die Holzbläser, namentlich Solo-Flöte und Oboe, und die düsteren Posaunen, die nicht dominieren, aber auch nicht als bloße Farbe im Tutti untergehen.
Die Seele des Unternehmens
Und dann natürlich die Seele des ganzen Unternehmens, Cecilia Bartoli. Ihr Theaterinstinkt blitzt ihr nach wie vor aus den Augen, ihre Lust am Singen teilt sich in jeder Phrase mit. Ihre vokale Gestik belebt den Text: Sie macht den sehrenden Eros des Orfeo, den verzweifelten Kampf gegen die Endgültigkeit des Todes, die Tränen der Sehnsucht, das Feuer des Flehens hörbar. Schon 2001 hat sie auf einem ihrer Alben in unnachahmlich individueller Art in Arien Glucks vertieft. Dieser Orfeo markiert einen Respekt heischenden Höhepunkt in der Befragung eines Komponisten, der im Opernbetrieb nicht so präsent ist, wie er es verdient. Bartoli zeigt, woran das liegen könnte: Glucks Musik braucht die innere Beseelung durch Sänger, die Wort und Musik zu einer existenziell berührenden Einheit verbinden. Nicht umsonst waren seine bedeutenden Partien stets eine Domäne großer Tragödinnen.
Zu bemerken ist aber auch, dass sich die oft benannten vokalen Schwächen der Bartoli trotz ihrer atemberaubenden Gestaltung deutlicher zeigen: Die enge tremolierende Tonbildung trübt homogene Legati und sublime Kantilenen; den dynamischen Steigerungen fehlt der freie Glanz. Aber dann gelingen berückend nuancierte leise Momente, singt ein gebrochener Mensch in fahlen Farben seine Verzweiflung aus. Und so gelingt es Cecilia Bartoli nach wie vor, die Zuhörer in den Sog ihrer Kunst zu ziehen und aus dem Alltag hinwegzutragen in das Elysium der Klänge Christoph Willibald Glucks und einer uralten antiken Tragödie, die uns auf diese Weise bis heute tief berührt.