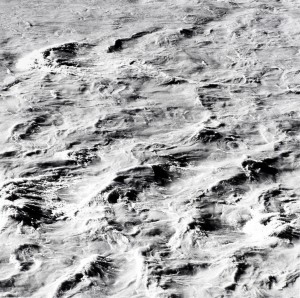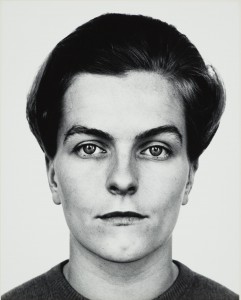Zum 100-jährigen Bestehen: Museum Folkwang lockt 2022 mit Impressionisten – und anderen Highlights

Kommt mit etlichen weiteren Bildern aus Japan nach Essen: Claude Monet „Sur le bateau (Jeunes filles en barque)“ – „Im Boot (Junge Mädchen im Ruderboot)“, 1887. Öl auf Leinwand (The National Museum of Western Art, Tokyo, Matsukata Collection)
Stolze 100 Jahre alt wird das Essener Museum Folkwang anno 2022. Zum Jubiläum haben der Museumsleiter Peter Gorschlüter und sein Team einiges vor, doch eine Ausstellung überstrahlt wohl alle anderen Projekte: „Renoir, Monet, Gauguin. Bilder einer fließenden Welt“ (ab 6. Februar 2022) dürfte eine jener Schauen werden, die – wenn nichts Arges dazwischenkommt – die magische Besuchsmarke von 100.000 übertreffen.
Just 1922, also vor bald 100 Jahren, wechselte die phänomenale Sammlung des Mäzens Karl Ernst Osthaus von Hagen nach Essen. Für Hagen war es ein bis heute nachwirkender, äußerst schmerzlicher Verlust, für Essen ein geradezu triumphaler Zugewinn.
Osthaus und sein ebenso kunstsinniger japanischer Zeitgenosse
Wenn demnächst in Essen rund 120 Werke des Impressionismus und seiner Ausläufer zu sehen sein werden, hat dies einen besonderen, quasi globalen Hintergrund: Etwa zeitgleich mit Osthaus tat sich der japanische Sammler Kojiro Matsukata in Europa und hier insbesondere in Paris um. Der Mann, der ein Schiffbau-Unternehmen betrieb, hatte es vor allem auf Impressionisten abgesehen – ganz ähnlich wie Osthaus.
Es mag durchaus sein, dass die beiden Sammler einander damals bei befreundeten Künstlern begegnet sind oder simultan dieselben Ausstellungen besucht haben. Es ist halt nur nicht überliefert. Jedenfalls werden in Essen Spitzenwerke aus beiden Sammlungen vereint. Zum großen Teil kommen die kostbaren Stücke aus Japan erstmals seit den 1950er Jahren wieder nach Europa. So kehrt auch Paul Signacs „Saint-Tropez“ (1901/1902), einst im Folkwang-Besitz, aus Japan erstmals wieder nach Essen zurück; auf Zeit, versteht sich.

Auf Zeit aus Japan nach Essen zurück: Paul Signac „Saint-Tropez“, 1901/02 – Der Hafen von Saint-Tropez, Öl auf Leinwand (The National Museum of Western Art, Tokyo, ehemals Museum Folkwang, Hagen/Essen)
In diesem Umfang ist die von Nadine Engel kuratierte Ausstellung nur möglich, weil das „National Museum of Western Art“ in Tokyo (ein 1959 eröffneter Bau nach Plänen von Le Corbusier), das die Schätze von Matsukata beherbergt, gründlich renoviert wird und daher geschlossen ist. Also kann das Haus etliche Werke verleihen – neben den im Titel genannten Künstlern sind u. a. auch Manet, Cézanne, Van Gogh und Rodin vertreten. Essen wird sich späterhin mit der leihweisen Gegengabe von rund 40 Meisterwerken bedanken, die im dann renovierten Tokyoter Museum gezeigt werden.
Plakate, Fotografie, Expressionisten, Helen Frankenthaler
1939 befand sich der Kernbestand der japanischen Sammlung in Frankreich und wurde als Feindbesitz (Kriegsgegner Japan im Zweiten Weltkrieg) vom französischen Staat beschlagnahmt. Vieles, doch nicht alles wurde hernach restituiert. Einige Lücken füllt nunmehr das Pariser Musée d’Orsay als weiterer Leihgeber. Man darf den Sensations-Begriff nicht leichtfertig bemühen, doch in diesem Falle…

Gehört zur Expressionisten-Ausstellung: Ernst Ludwig Kirchner „Tanzpaar“, 1914, Öl auf Leinwand (Museum Folkwang, Essen – Foto Jens Nober)
Ein paar weitere Jubiläums-Vorhaben sollen nicht unerwähnt bleiben: Unter dem passend appellierenden Titel „We want you!“ wird Plakat- und Werbekunst von den Anfängen bis heute ausgebreitet (ab 8. April 2022). Mit „Folkwang und die Stadt“ will sich das Museum mitten in die Stadtgesellschaft begeben, vorwiegend mit ortsbezogenen Kunstaktionen (ab 21. Mai), die derzeit noch entwickelt werden. „Expressionisten am Folkwang. Entdeckt – verfemt – gefeiert“ widmet sich einem zweiten Schwerpunkt der Sammlertätigkeit von Karl Ernst Osthaus (ab 20. August).
„Image Capital“ heißt ein Projekt, das – zwischen Wissenschaft und Kunst angesiedelt – Strategien und Techniken der Fotografie behandelt. Auch Themenbereiche wie Apps, Gaming, Simulation, Archivierung und manche Dinge mehr kommen dabei in Betracht (ab 9. September). Essen macht sich derweil berechtigte Hoffnungen auf die Gründung eines Deutschen Fotoinstituts daselbst, konkurriert aber immer noch mit Düsseldorf.
Schließlich wird es ab 2. Dezember 2022 eine Retrospektive zum Werk der abstrakten Expressionistin Helen Frankenthaler (1928-2011) geben. Museumschef Peter Gorschlüter findet, es sei „höchste Zeit“, das einflussreiche Werk der US-Amerikanerin wieder in den Blick zu nehmen, das seit Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr ausgiebig präsentiert wurde.
Kein Zweifel: Die Kunsthäuser der anderen Revierstädte werden sich anstrengen müssen, um im nächsten Jahr neben den Essener Glanzpunkten zu bestehen.