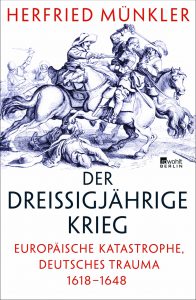Herausforderung glänzend bestanden: Essener Philharmoniker gastierten in Prag und Dresden mit einem Dvořák-Programm
Leichter Regen besprüht die monumentale Fassade des Rudolphinums am Ufer der Moldau. Nobel gekleidete Damen und Herren streben die Stufen empor, Fahnen wehen, die Portale sind geschmückt. Drinnen legen Musikerinnen und Musiker ihre Konzertkleidung an, Notenpulte und Stühle auf dem Podium werden zurechtgerückt. Üblicher Betrieb in einem Konzerthaus – und doch ist die Stimmung anders, festlicher, gespannter.

Das Rudolphinum, Prags historischer Konzertsaal und Auftrittsort der Essener Philharmoniker. Foto: Werner Häußner
Es ist Festivalzeit in Prag, und ein Orchester wartet auf seinen Auftritt, das nicht zu den üblichen Verdächtigen bei den internationalen Aufmärschen bekannter Klassikstars in Europa gehört: Die Essener Philharmoniker gastieren beim Internationalen Festival Dvořákova Praha, das seit seiner Gründung 2008 eine ganze Reihe Orchester aus der ersten Reihe nach Prag geholt hat: die beiden großen Londoner Orchester, das Orchestre Nationale de France, das City of Birmingham, das Israel Philharmonic – und eben jetzt, zum zweiten Mal nach 2017, die Essener Philharmoniker.
Schlüsselfigur: Chefdirigent Tomáš Netopil
Die sind nun nicht gerade ein zweitrangiges Orchester: Zwei Mal „Orchester des Jahres“, haben sich die Musiker unter Stefan Soltesz eine Spitzenstellung als Opernorchester unter den nicht wenigen Ensembles in Nordrhein-Westfalen errungen, gestalten in der 2004 wiedereröffneten Philharmonie Essen in erstklassiger Konzertsaal-Akustik begehrte Sinfoniekonzerte, haben beachtliche CD-Aufnahmen vorgelegt. Seit 2013 besetzt Tomáš Netopil den Posten des Chefdirigenten. Der Generalmusikdirektor konnte an die Arbeit von Soltesz anknüpfen und die Qualität des Orchesters systematisch weiter ausbauen. Er brachte viel – und nicht nur gängiges – tschechisches Repertoire in Konzerte und Oper ein und will diese Linie auch bis 2023 beibehalten. So lange steht er in Essen unter Vertrag, obwohl oder trotz er an großen Häusern, so auch an der Wiener Staatsoper und der Dresdner Semperoper, regelmäßig gastiert.

Tomas Netopil dirigiert die Essener Philharmoniker in der Frauenkirche in Dresden. Foto: Hamza Saad
Netopil ist auch der Mann, der das erste Prager Gastspiel eingefädelt hat. An der Moldau ist der ehemalige Musikdirektor des Nationaltheaters (bis 2012) beliebt und ein häufiger Gast auch beim renommiertesten Klangkörper, der Tschechischen Philharmonie. Das erste Konzert der Essener Philharmoniker 2017 schlug derart erfolgreich ein, dass sie samt ihrem Chef gleich für 2019 wieder unter Vertrag genommen wurden. Und für dieses Konzert ging Netopil aufs Ganze: Ein tschechischer Dirigent spielt mit einem deutschen Orchester Antonín Dvořák, jenen unter den tschechischen Komponisten, der anno 1896 im Rudolphinum das erste Konzert der Tschechischen Philharmonie dirigiert hatte und dessen Namen der gut 1000 Plätze fassende Saal heute trägt.
Der Umgang mit dem „böhmischen“ Klang
Auch vor dem Hintergrund der Geschichte, von der kulturellen Benachteiligung der Tschechen in der Habsburger Zeit bis hin zu den Barbareien der deutschen Besatzer in den dunklen sieben Jahren, darf ein solches Konzert also eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Außerdem: Wie würden die Essener Philharmoniker mit der Herausforderung des Klangs umgehen, mit jenem „böhmischen“ Ideal, das mit weicher, leuchtender Streicherintonation und schmeichelnden Bläsern identifiziert wird? Netopil hat, wie er im Gespräch verrät, in den Proben auf diesen Klang hingearbeitet, ohne ihn den Musikern überstülpen zu wollen: keine Imitation, aber eine Annäherung.

Probe im Rudolphinum in Prag. Foto: Werner Häußner
Dieses Konzept verträgt sich besonders mit dem sinfonischen Hauptwerk, der Siebten von Dvořák. In diesem für London geschriebenen Werk zeigt sich Dvořák eben nicht als „böhmischer Musikant“, verwendet keine Folklore-Anklänge, sondern demonstriert, dass er sinfonische Musik auf europäischem Niveau komponiert, die jedem Vergleich standhält. Die Eigenprägung der vier Sätze, drei davon in Moll, ihre formale Balance ist ebenso auf höchstem Niveau wie die dichte Satzarbeit besonders im Finale, und verbindet sich mit formaler Klarheit und einem leidenschaftlichen, energischen Puls.
Klarheit und Blick in die Tiefe
Genau so, mit Passion und Blick in die Tiefe, gehen die Essener Philharmoniker das Werk an. Die düster-unwirschen tiefen Streicher, der erste Ausbruch in den Trompeten, die ein lichtes Tongewölbe aufspannende Oboe, der markante Rhythmus, der unverkrampfte Fluss von Motiven und Themen: das Orchester spielt nachdrücklich und energisch. Die Bläser-Einleitung des zweiten Satzes gelingt gelöst und schwingend, im dritten Satz lebt der Rhythmus markant und locker zugleich. Netopil fordert Saft in den Tönen und zupackende Kraft, nimmt aber das Orchester auch zurück, wenn es den hohen, aber relativ kurz gebauten Saal zu überfordern droht. Keine leichte Aufgabe für die Musiker, die sonst in der offenen, freien Akustik der Essener Philharmonie spielen.

Die Essener Philharmoniker in der Frauenkirche Dresden. Foto: Hamza Saad
Im beliebten H-Dur-Nocturne op. 40 zu Beginn lässt der Saal den verhaltenen Klang der Geigen wärmer leuchten als in Essen; die trefflich aufeinander hörenden Musiker sichern die Balance, der Schluss schwebt leicht und leuchtend. Bei den beiden Sinfoniekonzerten in Essen und bei dem auf Prag folgenden Konzert in der Frauenkirche in Dresden stand das g-Moll-Violinkonzert von Max Bruch mit Arabella Steinbacher in der Mitte des klassischen Konzertprogramms. Was in Essen noch zögerlich im Zugriff und matt im Ton erklang, hatte in der Dresdner Frauenkirche spürbar Freiheit und Frische gewonnen.
Unterschätztes Klavierkonzert
In Prag spielte Ivo Kahánek das Dvořák’sche Klavierkonzert g-Moll. Die rhythmisch bewusst gestaltete, temperamentvolle Darbietung Kaháneks in geglückter Interaktion mit dem Orchester erweist dieses Konzert als unterschätzt. Dvořák schreibt auch hier Musik, die jenseits „nationaler“ Zuneigung oder Vorliebe auf internationalen Podien bestehen kann. Die enge Verknüpfung des solistischen und des orchestralen Materials, die poetische Schwermut des langsamen Satzes und der hinreißende rhythmische Bravour des Finales lohnen es, sich dieses Konzert genauer anzusehen.
Die Essener konnten mit den beiden Konzerten in Prag und Dresden einen erheblichen Erfolg für sich verbuchen. Die Kritiken in Prag waren ausgezeichnet, lobten die Tonqualität, die intensiven Farben, die flexible, kammermusikalische Begleitung des Pianisten. Die Planungen für weitere auswärtige Gastspiele der Philharmoniker laufen – für die Stadt Essen ist das Orchester zweifellos ein Kulturbotschafter erster Güte.